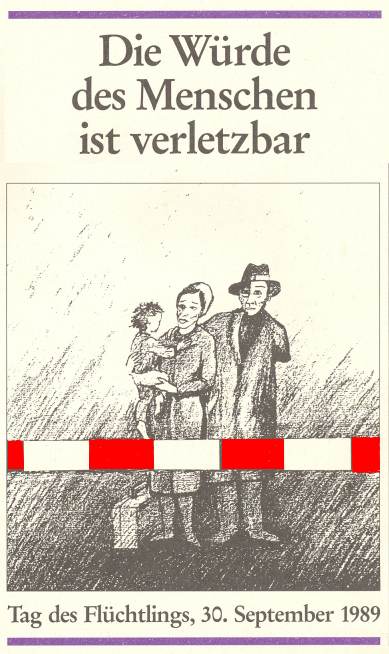TAG DES FLÜCHTLINGS 1989
Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen in der Bundesrepublik Deutschland
zum Tag des Flüchtlings 1989
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (1989)
- Grußwort der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (1989)
ANALYSEN
- Der Parlamentarische Rat und das Asylrecht
- „Festung Europa“ – zur neueren Entwicklung der Asylpolitik in der Europäischen Gemeinschaft
- 40 Jahre Grundrecht auf Asyl – ein Pfeiler unserer Verfassung
- Die Saat geht auf: Ausländerhaß
- Visumpflicht für Kinder?
- Verfolgt, weil Frau – kein Asylgrund?
- Asyl in der Kirche – Erfahrungen aus Berlin
- Abschiebungen in den Libanon?
BEISPIELE UND ANREGUNGEN
- Nicht politisch verfolgt? – Cengiz Dogu, ein Flüchtlingsschicksal
- Offener Brief an den Bundesinnenminister
- „Ich war fremd und obdachlos … und ihr habt mich aufgenommen“
- Stein des Anstoßes
- Container-Nacht-Aktion als Auftakt des Tages des Flüchtlings 1988 in Stuttgart
- Der Kölner Flüchtlingsrat zur Aussiedlerdiskussion
- Resolution der „Flüchtlinge in Berlin“
- Ökumenische Aktion in der Fußgängerzone
- Speisezettel weist den Weg aus der Isolation
- Nur Platz für Bett und zwei Stühle
- Statistik
- Materialhinweise / Adressen
Dieses Jahr begeht die Bundesrepublik Deutschland ihren 40. Geburtstag. Gewiß ein Anlaß zum Feiern. Wer konnte 1949 ahnen, daß dieses vom Krieg zerstörte Land 40 Jahre später als eines der wohlhabendsten Staaten der Welt gelten würde?
Die Bundesrepublik ist jedoch nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht ein blühendes Gemeinwesen. Sie ist, und dies zählt vielleicht noch mehr, durch ihren demokratischen Staatsaufbau und die verbrieften Rechte des einzelnen Bürgers zum Vorbild für jene geworden, die sich in ihrem Land noch um den Aufbau demokratischer Strukturen bemühen.
Ist es da verwunderlich, daß sich Menschen, in ihrer Heimat verfolgt, von Krieg, Unruhen und Zerstörung zermürbt, durch die Flucht in die Bundesrepublik Schutz und Sicherheit erhoffen? Muß man nicht stolz sein, Bürger eines Staates zu sein, von dem es auf der Welt heißt, dort drohe nicht die Gefahr staatlicher Willkür und Gewalt?
Der liberale, demokratische Rechtsstaat, wie er sich in der Bundesrepublik widerspiegelt, zeigt seine eigentliche Stärke nicht dadurch, daß eine Mehrheit entscheidet, sondern daß Minderheiten respektiert, wenn nötig geschützt werden.
Flüchtlinge sind eine solche schutzbedürftige Minderheit. Sie haben unseren Respekt, nicht unser Mitleid verdient. Die „Väter des Grundgesetzes“ haben dieser Einstellung Rechnung getragen: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ schrieben sie, nein nicht lapidar, sondern eindeutig vor 40 Jahren in die Verfassung.
Und ebenso selbstverständlich unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland als einer der ersten Staaten die Genfer Flüchtlingskonvention, durch die sich inzwischen über 100 Staaten verpflichtet haben, die Rechte eines Flüchtlings zu akzeptieren.
Eine wesentliche demokratische Tugend ist die Bereitschaft zur Toleranz, zum humanitären Handeln. Denn „was also in der Geschichte je Gutes getan ward, ist für die Humanität getan worden; was in ihr Törichtes, Lasterhaftes und Abscheuliches in Schwung kam, ward gegen die Humanität . . . verübt“, so der deutsche Philosoph Johann Gottfried Herder vor 200 Jahren.
Dies ist keine Phrase aus vergangener Zeit. Die Millionen von Toten der beiden Weltkriege und die ungezählten Opfer von Auseinandersetzungen nach 1945 haben dies in schrecklicher Konsequenz verdeutlicht.
Die Genfer Flüchtlingskonvention ist deshalb nichts anderes als die aus bitterer Erfahrung gewonnene Einsicht, daß humanitäre Prinzipien für die Opfer von Gewalt und Verfolgung in den internationalen Beziehungen sichergestellt werden müssen.
Was die Konvention allerdings nicht zu leisten vermag: den Ausbruch von Flüchtlingsbewegungen zu verhindern. Das weltweite Flüchtlingsproblem ist heute mit Sicherheit eines der größten Herausforderungen unserer Zeit. Seine Auswirkungen und Belastungen spüren vor allem die Länder der Dritten Welt.
Zum Vergleich: 100.000 Asylbewerber haben im vergangenen Jahr beim Zirndorfer Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ihren Antrag eingereicht. Damit hatte die Bundesrepublik die weitaus größte Zahl von Asylbewerbern in Europa zu verzeichnen. Malawi, ein Kleinstaat im südlichen Afrika, kaum größer als das Bundesland Nordrhein-Westfalen, hat innerhalb von 18 Monaten jedoch über 630.000 Flüchtlinge aufgenommen. Das gleiche gilt für das von inneren Konflikten geplagte Äthiopien, das rund 600.000 Flüchtlinge aus dem Sudan und Somalia innerhalb einer kurzen Zeitspanne unterbringen mußte.
Die Zahl der Flüchtlinge aus Ländern der Dritten Welt, die in europäischen Staaten um Asyl nachsuchen, ist hingegen vergleichsweise gering. Dennoch ist die Asyldiskussion in vielen europäischen Staaten ein brisantes innenpolitisches Thema, das Emotionen weckt.
Dabei spielt die Sprache eine große Rolle. Gerade in Zeiten des Umbruchs, wo die Menschen sich trotz glänzender
ökonomischer Bilanzen um die Zukunft sorgen, ist die Neigung verbreitet, komplexe Zusammenhänge in griffige Parolen aufzulösen.
Einfache Lösungen für schwierige Probleme sind gefragt. Die Forderung nach einer differenzierten Betrachtungsweise gerät zwangsläufig in Gefahr, ungehört zu bleiben. Doch wenn es um das Schicksal und die Existenz Zehntausender von Menschen geht, sind eben nicht voreilige Schlüsse, sondern Nachdenklichkeit geboten.
Diesen Schicksalen gerecht zu werden, ist nicht nur eine Aufgabe, die sich unserem Amt stellt. Mit der Genfer Flüchtlingskonvention hat sich die internationale Staatengemeinschaft ein anerkanntes und erprobtes Instrumentarium im Flüchtlingsrecht geschaffen. Es ist die Grundlage für einen Humanitären Ansatz bei der Asylgewährung. Ihre Kriterien sollten, wo immer möglich, im innerstaatlichen Recht Anwendung finden, um gerechte Entscheidungen treffen zu können.
Die geplante Harmonisierung des Asylrechts in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft ist in dieser Hinsicht Prüfstein und Chance zugleich. Die eher technische Frage, wer das Asylverfahren durchführt, gibt noch keine Antwort darauf, nach welchen Kriterien entschieden wird. Nur wenn auch dieses Problem im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention gelöst ist, kann von einer echten Harmonisierung des Asylrechts in den EG-Staaten gesprochen werden.
Aufklärung tut also not. Der Tag des Flüchtlings bietet hierzu die Gelegenheit. Nutzen wir die Chance zur Begegnung, vielleicht zur Konfrontation mit Problemen – erlebt als Schicksale. Denn allein um sie geht es.
Walter Koisser
Vertreter des Hohen Flüchtlingskomtuissars der Vereinten Nationen in der Bundesrepublik Deutschland