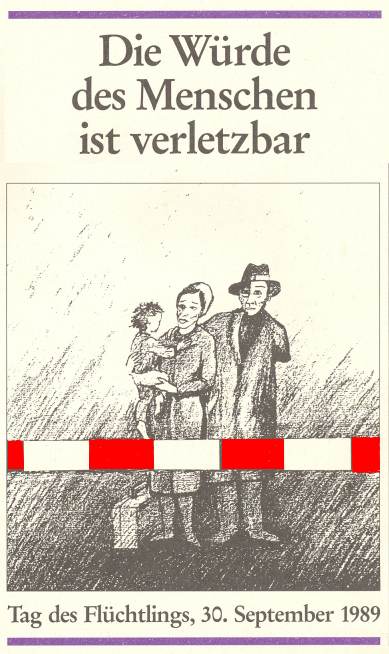TAG DES FLÜCHTLINGS 1989
„Festung Europa“ – zur neueren Entwicklung
der Asylpolitik in der Europäischen Gemeinschaft
Heide Langguth
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (1989)
- Grußwort der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (1989)
ANALYSEN
- Der Parlamentarische Rat und das Asylrecht
- „Festung Europa“ – zur neueren Entwicklung der Asylpolitik in der Europäischen Gemeinschaft
- 40 Jahre Grundrecht auf Asyl – ein Pfeiler unserer Verfassung
- Die Saat geht auf: Ausländerhaß
- Visumpflicht für Kinder?
- Verfolgt, weil Frau – kein Asylgrund?
- Asyl in der Kirche – Erfahrungen aus Berlin
- Abschiebungen in den Libanon?
BEISPIELE UND ANREGUNGEN
- Nicht politisch verfolgt? – Cengiz Dogu, ein Flüchtlingsschicksal
- Offener Brief an den Bundesinnenminister
- „Ich war fremd und obdachlos … und ihr habt mich aufgenommen“
- Stein des Anstoßes
- Container-Nacht-Aktion als Auftakt des Tages des Flüchtlings 1988 in Stuttgart
- Der Kölner Flüchtlingsrat zur Aussiedlerdiskussion
- Resolution der „Flüchtlinge in Berlin“
- Ökumenische Aktion in der Fußgängerzone
- Speisezettel weist den Weg aus der Isolation
- Nur Platz für Bett und zwei Stühle
- Statistik
- Materialhinweise / Adressen
Die wachsende Zahl von Asylsuchenden und Flüchtlingen, zumeist aus Ländern der Dritten Welt, hat in fast allen Staaten Europas zu verschärften Bestimmungen und praktischen Einschränkungen des Asylrechts geführt, obwohl nur ein kleiner Teil von den rund 15 Millionen Flüchtlingen in der Welt den Weg nach Europa findet.
Ungeachtet des humanitären Anspruchs und der besonderen Verantwortung Europas geschieht zu wenig, um zu einer menschenwürdigen Lösung des Problems beizutragen, es wird jedoch viel getan von den nationalen Regierungen und Behörden, um den Zuzug von weiteren Asylsuchenden abzuwehren.
Die Forderungen nach einer „Harmonisierung“ des Asylrechts und der Asylpolitik in Europa, die von verschiedenen Seiten und aus sehr unterschiedlichen Gründen erhoben werden, haben vielfältige Aktivitäten ausgelöst, die sich, je näher der Termin für die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes rückt, verdichten und an Bedeutung zunehmen. Viele dieser Arbeiten finden freilich unter weitgehendem Ausschluß der Öffentlichkeit statt und sind überdies der parlamentarischen Mitwirkung und Kontrolle entzogen.
Die Vorschläge des Europäischen Parlaments
Das Europäische Parlament ist die einzige europäische Institution, die durch allgemeine und direkte Wahlen in allen 12 Mitgliedsstaaten der EG zustande kommt. Diese besondere demokratische Legitimation hat das Parlament immer genutzt, um sich als Vorkämpfer für Bürger- und Menschenrechte der Probleme besonders anzunehmen, die in der Dynamik des wirtschaftlichen und währungspolitischen Einigungsprozesses als störend an die Seite gedrängt werden.
Schon in seiner ersten Wahlperiode (1979-1984) nahm das Europäische Par lament in vielen Resolutionen Stellung zu einzelnen Asylproblemen. Als sich diese aber auch in der zweiten Periode des EP (1984-89) zu häufen begannen, beschloß der zuständige Ausschuß für Recht und Bürgerrechte auf Anregung des ehemaligen DGB-Vorsitzenden Heinz Oskar Vetter dieses Problem grundsätzlich anzugehen und _ einen Bericht zur Lage des Asylrechts in der Europäischen Gemeinschaft auszuar beiten.
Nach gründlichen Vorarbeiten – Informationsreisen in verschiedene Mitgliedsstaaten, einer Anhörung von Experten im Rechtsausschuß – wurde sein Bericht mit der dazugehörenden Entschließung im Anschluß an eine große Debatte über „die Fragen des europäischen Asylrechts“ am 12. März 1987 mit großer Mehrheit vom Europäischen Parlament verabschiedet.
Im Unterschied zu den diversen europäischen Gremien, für die sich die Harmonisierung des Asylrechts auf ein Problem der Abwehr von Asylsuchenden und deren Kontrollierbarkeit an den Außen- und Binnengrenzen der Gemeinschaft reduziert, wird in dem Bericht von Heinz Oskar Vetter der Versuch unternommen, nach Ursachen und Struktur der heutigen Asylproblematik zu fragen und nach einem angemessenen europäischen Lösungsansatz zu suchen, der der oft beschworenen humanitären Tradition Europas gerecht werden könnte.
Der Bericht versucht, nicht nur die veränderten Ursachen für die Fluchtbewegungen in der Welt und die zunehmend restriktive Aufnahmepolitik, insbesondere der reichen Länder Europas, zu analysieren, sondern er geht auch von der Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft, die sich ja als Wirtschaft-, Rechts- und Sozialgemeinschaft versteht, gegenüber Flüchtlingen aus. Diese Verantwortung der EG ergibt sich:
- aus einer allgemein moralisch- menschlichen Verpflichtung gegenüber Menschen in Not;
- aus der besonderen historischen Rolle Europas als ehemalige Kolonialmacht;
- aus der heutigen Rolle der EG als einer führenden Industriemacht;
- aus der in internationalen, europäischen Verträgen, Abkommen, Konventionen eingegangenen Verpflichtung, die Würde des Menschen und die Menschenrechte zu achten und ihre Durchsetzung zu unterstützen.
Bisher versuchen die Mitgliedstaaten der EG, aber auch die meisten anderen Länder Westeuropas, durch vorwiegend nationale Regelungen ein internationales Problem zu bewältigen und so kommt es weder zu menschlich angemessenen Lösungen, noch zu einem vernünftigen europäischen Ausgleich.
Hier bieten der Bericht von Vetter und die Entscheidung des Europäischen Parlaments sinnvolle Vorschläge, von denen nur die wichtigsten aufgelistet werden sollen:
- Visabestimmungen dürfen keine Fluchtmöglichkeiten verhindern oder einschränken;
- die Grenz-, Einwanderungs- und Ausländerbehörden sollen das NichtZurückweisungsprinzip einhalten, und insbesondere jede Diskriminierung von spontanen Asylbewerbern (ohne Visum) vermeiden;
- Asylanträge müssen gründlich und zügig bearbeitet werden, die Entscheidung über den Asylantrag muß in den Mitgliedstaaten von einer zentralen Behörde nach persönlicher Anhörung des Bewerbers unter Vermeidung einer vorgeschalteten Zulässigkeitsprüfung getroffen werden, wobei sich der Antragsteller in einer von ihm beherrschten Sprache einlassen und soweit erforderlich kostenlose Rechtshilfe erhalten kann;
- die bestehenden internationalen Abkommen wie die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), die Übereinkommen und Entschließungen des Ministerrates des Europarates und die Texte der Vereinten Nationen müssen strikt respektiert werden;
- die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) müßten analog für alle Personen gelten, die wegen ihres Geschlechts oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden;
- die Entscheidung der Anerkennung oder Ablehnung ist dem Antragsteller persönlich in einer von ihm beherrschten Sprache und – im Falle der Ablehnung-mit einem ausdrücklichen Hinweis auf sein Berufungsrecht zur Kenntnis zu bringen;
- Die Entscheidung der Ablehnung des Asylbegehrens muß abschließend einer unabhängigen richterlichen Überprüfung und Berufung mit aufschiebender Wirkung unterzogen werden können;
- De-facto-Flüchtlinge sollen während der Dauer ihres Aufenthalts wie anerkannte Flüchtlinge behandelt werden; der Aufenthalt kann befristet werden;
- fortdauernde erzwungene Unterbringung in Sammelunterkünften, längerfristiges Arbeitsverbot, andauernde Residenzpflicht und längere Beschränkung der Bewegungsfreiheit sind zu vermeiden, dürfen jedoch sechs Monate nicht überschreiten, weil sie andernfalls gegen die Menschenwürde verstoßen;
- Die Organisationen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, sollen finanziell gefördert und an der Diskussion über die Asyl- und Flüchtlingspolitik beteiligt werden;
- Ausgleich zwischen den Mitgliedsstaaten, die in unterschiedlicher Weise durch den Zuzug von Asylsuchenden belastet werden; das Europäische Parlament empfiehlt dafür als Schlüssel den Haushalt der EG;
- der Rat wird aufgefordert, die Initiative zu einer besseren und gründlicheren Unterrichtung der europäischen Bürger über die Hintergründe der Flüchtlingspolitik zu ergreifen, um zu verhindern, daß Zweifel an der Pflicht der Mitgliedstaaten, zur Lösung des internationalen Flüchtlingsproblems beizutragen, und diesbezügliche Mißverständnisse aufkommen;
- die Kommission soll in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament einen EG-Beauftragten für Asylangelegenheiten einsetzen.
Zum gegenseitigen Stand einer europäischen Asylpolitik
Die Entwicklung einer europäischen Asylpolitik wird durch die Vollendung des europäischen Binnenmarktes entscheidend vorgezeichnet. An dem Prozeß der Harmonisierung des Asylrechts und der Asylpolitik wirken – meist hinter verschlossenen Türen – etliche europäische Institutionen und Gremien, von denen einige mehr schlecht als recht legitimiert sind: die Kommission der EG, die Ad-Hoc-Gruppe Einwanderung, Trevi, Schengen.
Die Rolle der Europäischen Kommission
Im Gesetzgebungsprozeß der Europäischen Gemeinschaft legt die Kommission dem Rat (dies sind die jeweiligen Fachminister der Mitgliedstaaten) den Vorschlag für ein Gesetz (meist in Form einer Richtlinie oder einer Verordnung) vor. Nach Beratungen und Stellungnahmen des Europäischen Parlamentes und des Wirtschafts- und Sozialausschusses, kann sie ihren Vorschlag ändern, über den der Rat dann endgültig entscheiden muß.
Im Juni 1985 legte die EG-Kommission ihr „Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes“ vor, in dem knapp 300 Bereiche aufgeführt sind, die durch eine europäische Gesetzgebung geregelt werden müssen, damit ab 1992 der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital, aber eben auch von Personen ohne Grenzen und Kontrollen möglich wird.
Unter Punkt 55 des 1. Teils, „Beseitigung der materiellen Schranken-III Personenkontrollen“, heißt es: „Ebenso werden spätestens 1988 Maßnahmen zum Asylrecht und zur Lage der Flüchtlinge vorgeschlagen. Die entsprechenden Entscheidungen sind bis spätestens 1990 zu fällen.“ Zu diesem Zweck soll eine „Richtlinie für die Koordinierung der Vorschriften betreffend das Asylrecht und den Flüchtlingsstatus“ bis 1988 vorgelegt werden. Diese Absicht der Kommission wurde wiederholt öffentlich bekräftigt, zuletzt im Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 1988.
Die Ausarbeitung eines Vorentwurfs dieser Richtlinie wurde der Generaldirektion III – Binnenmarkt und gewerbliche Wirtschaft – übertragen. Diese Zuteilung macht bereits deutlich, in welche Richtung bei der Ausarbeitung gedacht werden würde: wie bekommt man bei dem Wegfall der Binnengrenzen in der EG das Problem des freien Personenverkehrs in den Griff, vor allem dann, wenn diese Personen keine EG-Staatsbürgerschaft haben.
Ein erster Vorentwurf zu einer Richtlinie lag im Frühjahr 1988 vor und enthielt im wesentlichen Regelungsvorschläge für die Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten für folgende Bereiche:
- Zuständigkeit eines Mitgliedsstaates bei der Prüfung des Asylantrages;
- Situation des Asylbewerbers während seines Verfahrens;
- Koordinierung der Bedingungen für die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus;
- Abgekürztes Verfahren bei bestimmten Asylanträgen;
- Freizügigkeit für anerkannte Flüchtlinge;
- Beratender Ausschuß der EG zu Asylrechtsfragen.
Mitte März 1988 wurde dieser Vorentwurf von Experten der Mitgliedstaaten auf einem konsultativen Treffen in Brüssel diskutiert und kritisiert. Die bisher bekanntgewordenen Einwände an diesem Vorentwurf reichen von der Kritik an der gewählten Rechtsgrundlage bis hin zur Ablehnung der Richtlinie überhaupt mit der Begründung, daß die Gemeinschaft auf diesem Gebiet überhaupt keine Gesetzgebungskompetenz habe. Der Vorentwurf wurde überarbeitet, übersetzt und liegt nach erneuten und ergebnislosen Diskussionen seit Mitte des Jahres 1988 unter Verschluß.
Es wird also darauf ankommen, wie die neue Kommission an dieses Problem herangehen will und was sie politisch erreichen kann. Kommissar Bangemann, in dessen Gebiet die Asylrechtsproblematik fällt, wurde von der Kommission als Koordinator für diese Fragen ernannt. Ob er einen erneuten Vorstoß für die Gemeinschaftsregelung wagen wird, muß sich zeigen.
Die TREVI-Gruppe
In der Diskussion um eine Harmonisierung des Asylrechts taucht immer wieder der Begriff TREVI-Gruppe auf.
Im November 1975 beauftragte der Europäische Rat in Rom die Innen- und Justizminister, Fragen der „öffentlichen Ordnung“ zu diskutieren, insbesondere solche, die mit Terror- und Drogenbekämpfung auf polizeilicher Ebene zu tun haben.
Die Sitzungen der TREVI-Gruppe finden außerhalb des Gemeinschaftsrahmens und ohne jegliche Öffentlichkeit statt; selbst Beobachter der Kommission können noch nicht einmal als Beobachter teilnehmen. Angeblich beschäftigt sich die TREVI-Gruppe nicht mit Fragen des Asylrechts; allerdings tagte sie mehrfach zur selben Zeit und am selben Ort wie die Ad-hoc-Gruppe „Einwanderung“ .
Die Einwanderungsminister und ihre Ad-Hoc-Gruppe
Ebenfalls außerhalb des Gemeinschaftsrahmens laufen die Arbeiten der Ad-Hoc-Gruppe „Einwanderung“, die die zwölf für Einwanderungsfragen zuständigen Minister in den EG-Mitgliedstaaten (in der Regel die Innen- oder Justizminister) im Oktober 1986 in London beschlossen haben. Diese Ad-Hoc-Gruppe „Einwanderung“ hat wiederum eine Untergruppe „Asyl“ eingesetzt, die sich vor allem mit Fragen beschäftigt, wie es beim Wegfall der Binnenkontrollen mit dem freien Personenverkehr, also auch dem der Asylbewerber und Flüchtlinge steht, und wie man an den Außengrenzen der EG den Zugang von ihnen besser kontrollieren, d. h. begrenzen kann.
Die Ad-Hoc-Gruppe „Einwanderung“ tagt im Halbjahres-Turnus und ebenfalls unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Für ihre Arbeit steht ihr das Sekretariat des Rates zur Verfügung, obwohl es dafür weder eine rechtliche Grundlage gibt, noch sind im EGHaushalt dafür Mittel vorgesehen. Im Unterschied zur TREVI-Gruppe darf die EG-Kommission in diese Ad-Hoc-Gruppe einen Beobachter entsenden, nicht aber der UNHCR oder der Europarat.
Die Schengen-Gruppe
Von großer Bedeutung für die künftige Asylpolitik in der Gemeinschaft sind die Arbeiten, die von den Mitgliedern des Schengener Abkommens vorangetrieben werden.
Das zwischenstaatliche Abkommen wurde im Juni 1985 in Schengen (Luxemburg) von den Beneluxstaaten, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland geschlossen. Ziel ist der schrittweise Abbau der Grenzkontrollen zwischen den Vertragspartnern bis zum 1.1.1990. Dazu wurden die Arbeitsgruppen Polizei und Sicherheit, Personenverkehr (u. a.: Asyl), Zoll und Warenverkehr, Transport gebildet, die die „technischen“ Voraussetzungen für den Abbau der Personenkontrollen an den Binnengrenzen schaffen sollen.
Inzwischen liegt ein nahezu unterschriftsreifes Zusatzabkommen mit insgesamt 37 Artikeln vor, in denen festgelegt wird, daß parallele und/oder sukzessive Asylanträge von Bewerbern in verschiedenen Mitgliedsstaaten des Abkommens nicht mehr zulässig sein sollen. Außerdem werden Kriterien für die Zuständigkeit eines Landes zur Prüfung eines Asylantrages aufgestellt und die Reisemöglichkeiten von Asylbewerbern und Flüchtlingen innerhalb der EG geregelt. Darüber hinaus ist die Einrichtung des „Schengener Informationssystems“ vorgesehen, in dem nicht nur Informationen über die politische Lage in den Herkunftsländern der Asylbewerber gespeichert und abgerufen werden können, sondern auch persönliche Daten über einzelne Asylbewerber und deren Anträge.
An den Beratungen der Schengen-Gruppe kann ein Beobachter der EG-Kommission teilnehmen, aber ansonsten finden auch hier die Sitzungen, bisher gab es sechs, – im Geheimen statt.
Das Interesse der anderen europäischen Staaten an diesem Abkommen ist groß. Italien wollte schon lange beitreten, durfte aber bis jetzt nicht, Österreich und auch Spanien wollen sich evtl. ebenfalls dem Abkommen anschließen.
Die Aussichten: „Festung Europa“?
Wenn nicht alles täuscht, wird es in der ersten Jahreshälfte in Europa zu wichtigen Änderungen in der Asylpolitik kommen. Vieles deutet darauf hin, daß dabei die Schengener Gruppe, die geographisch gesehen das Kerngebiet der Gemeinschaft umfaßt, politisch eine Vorreiterrolle bei der Harmonisierung der Asylpolitik in Europa, genauer in der EG, spielen wird.
Es sieht zur Zeit so aus, als habe sich die Kommission der EG, die ja zunächst mit dem Vorentwurf für eine Gemeinschaftsrichtlinie gesetzgeberisch tätig wurde, die Initiative aus der Hand nehmen lassen. Offenbar waren die Widerstände der nationalen Regierungen und ihre materiellen und politischen Interessengegensätze größer als die Bereitschaft, zu einer Gemeinschaftsregelung in der EG zu gelangen. Dies wäre auch eine Erklärung für die vielen verschiedenen Arbeitsgruppen und Gremien, die zwar außerhalb des formalen Rahmens der Gemeinschaft angesiedelt sind, die aber mehr oder weniger mit Personen besetzt sind, die wenn nicht gar personalidentisch – aus denselben Ministerialbürokratien kommen. Und so wundert es einen nicht, daß sie auch alle an fast den gleichen Themen mit der gleichen Zielsetzung arbeiten und zu fast denselben Ergebnissen kommen. Alle diese Ergebnisse, soweit sie bis jetzt bekannt geworden sind, lassen aber für ein humanes Asylrecht und eine menschenwürdige Asylpolitik in Europa Schlimmes befürchten. 12.2.1989
Heide Langguth ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro Heinz-Oskar Vetter (MdEP).