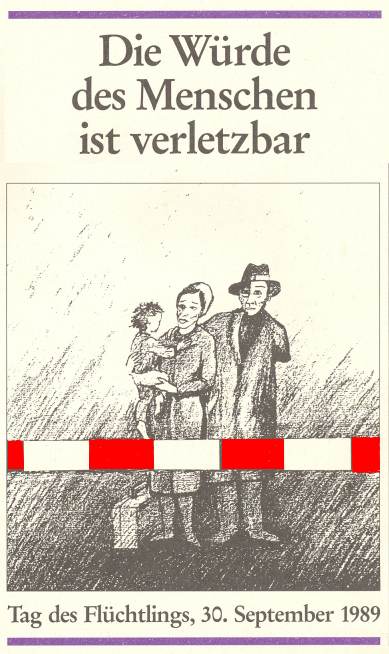TAG DES FLÜCHTLINGS 1989
Verfolgt, weil Frau – kein Asylgrund?
Margit Gottstein
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (1989)
- Grußwort der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (1989)
ANALYSEN
- Der Parlamentarische Rat und das Asylrecht
- „Festung Europa“ – zur neueren Entwicklung der Asylpolitik in der Europäischen Gemeinschaft
- 40 Jahre Grundrecht auf Asyl – ein Pfeiler unserer Verfassung
- Die Saat geht auf: Ausländerhaß
- Visumpflicht für Kinder?
- Verfolgt, weil Frau – kein Asylgrund?
- Asyl in der Kirche – Erfahrungen aus Berlin
- Abschiebungen in den Libanon?
BEISPIELE UND ANREGUNGEN
- Nicht politisch verfolgt? – Cengiz Dogu, ein Flüchtlingsschicksal
- Offener Brief an den Bundesinnenminister
- „Ich war fremd und obdachlos … und ihr habt mich aufgenommen“
- Stein des Anstoßes
- Container-Nacht-Aktion als Auftakt des Tages des Flüchtlings 1988 in Stuttgart
- Der Kölner Flüchtlingsrat zur Aussiedlerdiskussion
- Resolution der „Flüchtlinge in Berlin“
- Ökumenische Aktion in der Fußgängerzone
- Speisezettel weist den Weg aus der Isolation
- Nur Platz für Bett und zwei Stühle
- Statistik
- Materialhinweise / Adressen
Zum Beispiel Frau A., Tamilin aus Sri Lanka. Ihr Mann, Mitglied einer Befreiungsorganisation, mußte fliehen. Er ging in die Bundesrepublik und beantragte Asyl. Frau A., die mit ihren Kindern in Sri Lanka geblieben war, wurde von singhalesischen Sicherheitskräften aufgesucht. Sie wollten wissen, wo sich ihr Mann aufhielt. Sie vergewaltigten Frau A.
Eine hinduistische Tamilin, die vergewaltigt wurde, muß Selbstmord begehen. Nimmt sie sich nicht das Leben, so darf sie nie über ihr Schicksal sprechen.
Frau A. folgte ihrem Mann in die Bundesrepublik und beantragte ebenfalls Asyl. Nach einer ersten Ablehnung des Asylantrags vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge rang sie sich dazu durch, im Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht zu erklären, was sich hinter dem Satz verbirgt: „Die Polizei kam in mein Haus.“ Auf diese Weise erfuhr ihr Mann von der Vergewaltigung. Frau A. wurde von ihrem Mann verstoßen. Sie lebt jetzt mit ihren Kindern allein.
Die Rede von der doppelten Verfolgung von Frauen ist keine feministische Übertreibung. Die Erlebnisse vieler Frauen legen Zeugnis davon ab, daß sie tatsächlich zwei Verfolgern zum Opfer fielen: zuerst dem Staat, dann den Normen ihrer Kultur oder Gesellschaft.
Oder umgekehrt.
Zum Beispiel Sarah, aus einem islamischen Land. Sarah weigerte sich, den Mann zu heiraten, den ihre Eltern für sie ausgesucht hatten. Von dem Freund, den sie auf ihrer Arbeitsstelle kennengelernt hatte, durfte die Familie nichts erfahren. Sarah verließ ihre Familie, nachdem sie erleben mußte, daß ihre Cousine von ihren Brüdern getötet wurde, als diese von der Beziehung zu einem fremden Mann erfahren hatten.
Eine rein private, familiäre Angelegenheit?
Die Brüder der Cousine wurden verhaftet, aber nach wenigen Tagen wieder freigelassen. Begründung: sie hätten eine wertvolle Tat begangen und die Ehre der Familie wiederhergestellt.
Sarah mußte ihr Land verlassen.
Das Bundesverfassungsgericht führte in einer Entscheidung aus dem Jahre 1980 aus: „Wie die Geschichte lehrt…, gehören religiöse Beweggründe und Ziele seit jeher zu den häufigsten und wichtigsten Ursachen für die „Unterdrückung und Verfolgung Andersdenkender“ (BVerfG, B. v. 2.7.1980). Die Erkenntnis, daß auch sexistische Beweggründe und Ziele zu den klassischen Verfolgungsgründen gehören, ist in der Asylpolitik dagegen erst wenige Jahre jung. Im Asylrecht ist dieser Verfolgungsgrund nicht ausdrücklich vorgesehen – im Gegensatz übrigens zu den Diskriminierungsverboten im bundesdeutschen und internationalen Recht. Art. 1 A 2 der Genfer Flüchtlingskonvention kennt nur Verfolgungen aufgrund der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung. Entsprechend zögernd wird in der Praxis der Asylgewährung auf geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe eingegangen.
Tamilinnen, die wie Frau A. Verfolgungen durch sexuelle Gewalt vor Gericht zur Sprache brachten, wurden in allen bisher bekannt gewordenen Fällen im Asylverfahren abgelehnt. Noch kein Gericht hat dabei in Frage gestellt, daß tamilische Frauen und Mädchen zunehmend von sexuellen Übergriffen bedroht sind. Asylrechtlich relevant, so die Gerichtsentscheidungen, sei diese drohende Verfolgung aber nicht: Wo Tamilinnen – wie im Norden und Osten Sri Lankas – willkürliche und wahllose sexuelle Übergriffe befürchten müssen, werden diese als typische Maßnahmen im Rahmen der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen bewertet. Wo dagegen – wie im überwiegend singhalesisch besiedelten Süden der Insel Tamilinnen nur vereinzelt Opfer von Vergewaltigungen werden, könne nur von allgemeiner Kriminalität, nicht aber von politischer Verfolgung gesprochen werden. In keinem der beiden Fälle ist die drohende Verfolgung „asylerheblich“. Die herrschende Rechtsmeinung besagt nämlich, daß Verfolgungen im Rahmen von Bürgerkriegen sowie allgemeiner Kriminalität nur dann asylrelevant sind, wenn sie über das hinausgehen, was die Bevölkerung des Landes allgemein hinzunehmen hat. Nur das Oberverwaltungsgericht Berlin befaßte sich in diesem Zusammenhang mit den speziellen Normen für tamilische Frauen in ihrer Gesellschaft, allerdings nur, um ein mögliches Argument für eine Anerkennung im Asylverfahren zu verwerfen. Dem srilankischen Staat seien die Übergriffe auf Tamilinnen nicht zuzurechnen, weil „tamilische Vergewaltigungsopfer aufgrund ihrer hinduistisch-tamilisch geprägten Erziehung häufig von einer Anzeige in solchen Fällen absehen und deshalb staatlichen Schutz gar nicht in Anspruch nehmen“ (Urteil vom 1.9.1986).
Asylsuchende Frauen, die wie Sarah in erster Linie befürchten, wegen Verstößen gegen speziell für Frauen geltende Normen verfolgt zu werden, kommen derzeit vorwiegend aus dem Iran. Ihnen wird vor allem mit den folgenden Argumentationsmustern asylrechtlicher Schutz verweigert:
- „Private“ Verfolgungen werden grundsätzlich nicht als asylrelevant anerkannt. Die Verfolgung muß immer vom Staat ausgehen. Nur wenn staatliche Organe die Verfolgungsmaßnahmen Dritter unterstützen oder dulden, kann die Verfolgung dem Staat zugerechnet werden.
Sarah sah sich mit genau diesem Problem konfrontiert. Bei der Anhörung vor dem Bundesamt wurde sie nach der drohenden Verfolgung durch die Familie erst gar nicht befragt. Auf Intervention ihrer Begleiterin erklärte der anhörende Beamte, diese rein private Bedrohung spiele für das Asylverfahren keine Rolle. Er ließ sich dann aber überzeugen, daß die Umstände um den Mord an Sarahs Cousine belegten, daß derartige Sanktionen durch die Familie von staatlichen Stellen gebilligt bzw. unterstützt würden und von daher eine politische Verfolgung in Betracht zu ziehen sei.
- Iranerinnen, die ihre Furcht vor Übergriffen der Revolutionswächter, vor Inhaftierung und Auspeitschung nach Ubertretung der Kleidervorschriften zum Gegenstand ihres Asylverfahrens machen, wird entgegengehalten: bisher lasse sich nicht aufklären, mit, welcher Motivation Revolutionswächter gegen Frauen vorgehen, die gegen Kleidervorschriften verstoßen. Asylrelevant wäre nur, wenn die Pasdaran mit ihren Übergriffen beabsichtigten, ein regimefeindliches Verhalten der betroffenen Frauen sanktionieren zu wollen. Noch häufiger werden asylsuchende Iranerinnen aber abgelehnt, weil bundesdeutsche Gerichte das islamische Recht zum Maßstab. ihrer Bewertung machen. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg z.B. lehnte es ab, eine Verfolgung im asylrechtlichen Sinn anzunehmen, weil „sich die Iranische Republik als islamischer Staat im Sinne des radikalen Fundamentalismus versteht und damit nicht an dem weltanschaulichen Neutralitäts- und Toleranzgebot des Grundgesetzes gemessen werden kann“ (Urteil vom 18. 3.1988).
Voraussetzung einer sachgerechten Bewertung geschlechtsspezifischer Verfolgung von Frauen im Asylverfahren bleibt die Berücksichtigung ihrer sozialen Stellung und der speziellen Normen, die Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts zugeschrieben werden. Vor diesem Hintergrund erst wird deutlich, daß sexuelle Gewalt kein beliebiges Mittel der Verfolgung ist. Sexuelle Ubergriffe zielen immer auch darauf,
- die politische Gegnerin auf ihre traditionelle Rolle als Frau zurückzuverweisen,
- den untergeordneten sozialen Status von Frauen in ihrer Familie oder Gruppe auszunutzen und so gleich zwei Ziele zu erreichen: zum einen werden Frauen zusätzlich den sozialen Folgen wie Aufforderung zum Selbstmord oder Ächtung ausgesetzt, zum anderen wird die Familie oder Gruppe getroffen, der es nicht gelingt, „ihre“ Frauen zu schützen. Hier – wie auch im Fall der Iranerinnen, die wegen Übertretung speziell fur sie geltender (Kleider- )Vorschriften verfolgt werden – tritt die politische Motivation der Verfolgung und damit ihre Asylrelevanz deutlich zutage: die Übergriffe zielen darauf, die untergeordnete soziale Stellung von Frauen aufrechtzuerhalten, wiederherzustellen oder auszunutzen für andere Ziele.
Mit einer Resolution vom 13.4.1984 reagierte das Europaparlament als erstes politisches Gremium auf die besonderen Schutz Bedürfnisse von Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts verfolgt werden. Es empfahl den EG-Staaten, Frauen, die wegen Übertretung moralischer oder ethischer Regeln ihrer Gesellschaft Opfer grausamer und unmenschlicher Behandlung werden, als Zugehörige zu einer bestimmten (sozialen Gruppe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention den Flüchtlingsstatus zu gewähren. Das Exekutivkomitee des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen hat dieser Auslegung der Genfer Flüchtlingskonvention 1985 zugestimmt.
In der Bundesrepublik haben die weiblichen .Abgeordneten der vier im Bundestag vertretenen Parteien die Bundesregierung in einer Großen Anfrage vom März 1988 gefragt, ob sie sich dem anschließen wolle. In ihrer Antwort weist die Bundesregierung darauf hin, daß die Entscheidung über die Asylgewährung allein beim Bundesamt bzw. bei den Gerichten liegt. Dort wird – auf der Grundlage des Art. 16112 GG – derzeit Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts verfolgt wurden, die Asylberechtigung jedoch in den meisten Fällen versagt.
In dieser Situation sind die verantwortlichen Politiker nicht aus der Pflicht entlassen, für den Schutz der im Asylverfahren abgelehnten, aber dennoch bedrohten Frauen Sorge zu tragen. Wo politischen Flüchtlingen eine Asylberechtigung nach Art. 16 11 2 GG versagt bleibt, greift in einigen Fällen die Genfer Flüchtlingskonvention. Vor diesem Hintergrund sind die verantwortlichen Politiker aufgefordert, Frauen und Mädchen, die in ihren Heimatländern Opfer grausamer und unmenschlicher Behandlung werden würden, weil davon ausgegangen wird, daß sie moralische oder ethische Regeln ihrer Gesellschaft übertreten haben, als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu behandeln und ihnen Flüchtlingspässe zu erteilen.