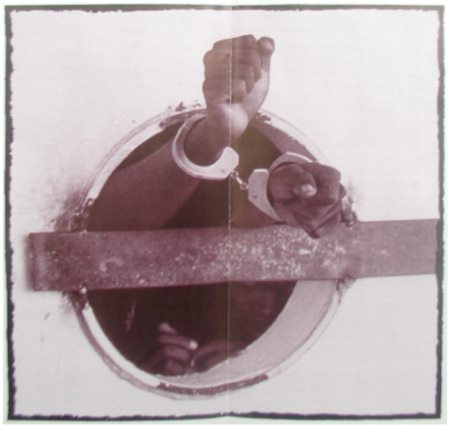TAG DES FLÜCHTLINGS 1993
Kirchenasyl
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR)
- Auf dem Weg nach rechts
- Der Engel von Marseille
- „Hört auf, vom Mißbrauch des Asylrechts zu reden“
- Fehlentscheidungen des Bundesamtes – Korrektur durch Gerichte
- In die Flucht geschlagen: Warum Menschen fliehen
- Kirchenasyl
1. Informationen für die Gemeinden
In fast allen Gemeinden leben ausländische Flüchtlinge. Gelegentlich unbemerkt oder schlecht gelitten, vielfach aber in guter Nachbarschaft mit unseren Gemeindemitgliedern.
In Gemeinden, in denen einzelne Mitglieder oder Arbeitskreise die Flüchtlinge unterstützen, ist hinreichend bekannt, wie schwierig diese Aufgabe oft ist. Nicht selten sind Auseinandersetzungen mit den Behörden nötig, um den Flüchtlingen zu ihrem Recht zu verhelfen: eine vernünftige Unterkunft zu bekommen, ausreichende Sozialhilfe oder Arbeitsmöglichkeiten zu erhalten, für die Kinder Schul- und Ausbildungsplätze zu finden…
Oft müssen sich die Unterstützer/innen aber mit einer Situation auseinandersetzen, mit der Flüchtlinge im Laufe ihres Aufenthaltes bei uns konfrontiert werden – der Aufforderung, die Bundesrepublik möglichst umgehend wieder zu verlassen.
Unser grundgesetzlich verbürgtes Asylrecht ist durch Verwaltungsentscheidung und Rechtsprechung mittlerweile soweit ausgehöhlt, daß nur noch vier oder fünf Prozent aller Asylsuchenden auf dem Verwaltungswege und nach Schätzungen noch einmal dieselbe Anzahl im Gerichtsverfahren als asylberechtigt anerkannt werden. Viele der abgewiesenen Asylsuchenden wären jedoch bei einer Rückkehr in ihr Heimatland gleichwohl aus den unterschiedlichsten Gründen gefährdet. Deshalb wurde auch bisher vielen dieser Menschen (nach Schätzungen etwa 60%) der weitere Aufenthalt in der Bundesrepublik aus rechtlichen, humanitären, politischen oder verfahrenstechnischen Gründen gewährt. Weil offensichtlich eine politische Verfolgung oder sonstige erhebliche Gefährdung im Heimatland vorgelegen hat, wird eine Gruppe von Flüchtlingen (z. B. Tamilen, Christen und Yeziden aus der Türkei oder auch Kriegsflüchtlinge) durch Erlasse des Landes für die Dauer von sechs Monaten vor Abschiebung geschützt. Aber diese Regelungen werden wahrscheinlich bald restriktiven Bestimmungen des neuen Asylverfahrensrechts und der in unserem Lande zu beobachtenden allgemeinen Tendenz der verstärkten Verdrängung und Abwehr von Flüchtlingen zum Opfer fallen. Wenn nicht von einheimischen Initiativen oder Kirchengemeinden und Wohlfahrtsverbänden geholfen wird, wird die Abschiebung bald das Schicksal von vielen Flüchtlingen sein.
2. Zur theologischen Frage von Kirchenasyl
Die Menschenwürde jedes Menschen, entwickelt von Gen. 1, 27 („Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“), ist Grundlage für das Engagement von Kirchengemeinden zugunsten von Flüchtlingen und Minderheiten. Die Würde des Menschen konkretisiert sich in Menschenrechten, die sich insbesondere an diejenigen richten, deren Rechtsposition in der Gesellschaft eine schwache ist.
In diesem Zusammenhang ist der Artikel 16.2 unseres Grundgesetzes zu verstehen: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“
Kirchenasyl bedeutet theologisch, das Menschenrecht der in ihrer Existenz bedrohten Flüchtlinge, wie es sich auch in Artikel 16.2 GG manifestiert, „einzuklagen“. Kirchenasyl kann somit eine Entscheidung des Glaubens zugunsten des Gottes sein, „der Himmel und Erde gemacht hat“.
3. Rechtliche Aspekte des Kirchenasyls (siehe Anlage)
Sowohl nach katholischem Kirchenrecht als auch nach evangelischem Verständnis kann Kirche in juristischem Sinne kein Asyl gewähren. Damit ist klar, daß Kirchenasyl immer nur eine zeichenhafte Handlung sein kann. Dies bedeutet in der Konsequenz, daß selbstverständlich staatliche Behörden (Polizei) das Recht haben, Menschen aus Kirchen herauszuholen. Praktisch scheuen sich staatliche Organe, in eine Kirche gegen den Willen des Hausherrn einzudringen. Ordnungsrechtliche Maßnahmen würden einen Konflikt zwischen Kirche und Staat öffentlich manifestieren.
Zur Straffolge: Das Grundrecht der Gewissensfreiheit ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch wertentscheidende Grundsatznorm, die bei Staatstätigkeit jeder Art, auch bei Strafzumessung, Wertmaßstäbe setzende Kraft entfaltet. Es besteht daher von Verfassung wegen ein Wohlwollensgebot gegenüber Gewissentätern. Dies gilt in nicht anderer Weise auch für das Handeln aus Glaubensgründen.
4. Fragen zum Kirchenasyl
Bevor die Gemeindeversammlung im konkreten Einzelfall die Gewährung von Kirchenasyl beschließt, sollten vorher wichtige Fragen geklärt oder zumindest besprochen worden sein (siehe Anlage 4).
Eine Gemeinde, die sich ernsthaft mit dem Schutz für Flüchtlinge auseinandersetzt, wird ihre Entscheidung, Asyl zu gewähren, nicht von der restlosen Vorabklärung aller Einzelheiten abhängig machen. In den Fällen bisher gewährten Kirchenasyls hat sich auch für den jeweiligen Initiatoren und Aktiven ein vermutlich kaum geahntes Engagement und Solidaritätsgefühl entwickelt. Dennoch: Gemeindeversammlung und aktiv Beteiligte sollten sich über Ziel, Durchführung und Konsequenzen der Aktion von vornherein so weit wie möglich im klaren sein.
4.1 Ziel des Kirchenasyls (siehe Anlage 4)
Das Ziel, das mit dem Kirchenasyl erreicht werden soll, sollte so genau wie möglich definiert sein. Die Formel „Stoppt die Abschiebung“ genügt im Einzelfall nicht.
Ob symbolische oder tatsächliche Schutzgewährung: die Gemeinde wird sich in der Regel für ein offenes demonstratives Verfahren entscheiden. Sie demonstriert mit der Gewährung von Unterkunft in Kirche oder Gemeindehaus für den Schutz des bedrohten Lebens und für das Ernstnehmen der Angst des Flüchtlings vor Schikanen, Strafen oder unsäglichen Lebensbedingungen bei Heimkehr. Einige, möglichst viele Gemeindemitglieder betreuen die Flüchtlinge, um deutlich zu machen, daß mit der hier beabsichtigten Abschiebung Unrecht geschieht. Sie drücken damit aus: Wir geben gewaltlos Schutz und erinnern damit an Gottes höheres Recht, indem wir uns hier in der Kirche augenfällig mit den Flüchtlingen solidarisieren.
Die Gemeinde singt, betet, hält u. U. jeden Abend Gottesdienst und lädt zu anderen Gemeindeveranstaltungen in Gegenwart der Flüchtlinge ein und gibt Polizei, Behördenvertretern und Journalisten offen Auskunft darüber, warum hier ziviler Ungehorsam geleistet wird; unter Berufung auf Gottes Barmherzigkeit und Gebot, in Kenntnis der Gesetzeslage und der tatsächlichen Lebensumstände und Erfahrungen der Flüchtlinge in ihrem Heimatland. Die Gemeinde appelliert an die Öffentlichkeit, insbesondere an die Behörden und die politischen Institutionen und Parlamente, hier die Menschenrechte nicht durch gewaltsame Abschiebung zu verletzen.
4.2 Organisatorische Fragen zum Kirchenasyl
- Wo sollen die zu schützenden Flüchtlinge untergebracht werden: Kirche, Pfarr- oder Gemeindehaus, sonstige zur Gemeinde gehörenden Räumlichkeiten?
- Welche Gemeindemitglieder oder sonstigen engagierten Personen sind bereit, bei der Versorgung der Flüchtlinge mitzuwirken, „Wachdienste“ zu übernehmen, Telefonketten zu organisieren, für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zu zeichnen, Verhandlungen mit den Behörden zu übernehmen?
- Wie kann die Finanzierung der Aktion sichergestellt werden: für die Versorgung der Flüchtlinge und für die Öffentlichkeitsarbeit können nicht unbeträchtliche Kosten anfallen?!
- Wie lange soll Kirchenasyl gewährt werden (für einige Tage oder Wochen, im Rahmen einer symbolischen Aktion oder ggf. über mehrere Monate, bis definitive Entscheidungen gefallen sind)?!
- Wie sind die potentiellen Befürworter (z. B. Persönlichkeiten aus der liberalen Öffentlichkeit) zu gewinnen (wer hat Kontakte?), wie können Kritiker erreicht, informiert und umgestimmt werden?
- Sind bzw. wie können Erfahrungen aus anderen Kirchengemeinden (die schon Kirchenasyl gewährt haben) nutzbar gemacht werden?
4.3 Betreuung der aufgenommenen Flüchtlinge
- Fragen Sie die Flüchtlinge nach der Vorgeschichte ihres Falles, nach allen Rechtsanwälten, Beratungsstellen, Unterstützern etc., die sich bisher um ihren Fall gekümmert haben. Nehmen Sie Kontakt zu diesen Personen auf. Unterrichten Sie auch die Bischöfe und die kirchlichen Beauftragten für Ausländerarbeit.
- Sprechen Sie das Vorgehen regelmäßig mit der betreuenden Beratungsstelle und mit dem Rechtsanwalt/der Rechtsanwältin ab.
- Bilden Sie eine verantwortliche Betreuergruppe, die regelmäßige Treffen für alle interessierten Gemeindemitglieder durchführt. Beteiligen Sie dabei vor allem auch die betroffenen Ausländer.
- Sprechen Sie mit den Flüchtlingen über ihre weitere Lebensperspektive für den Fall, daß die Abschiebung verhindert werden kann und was Sie im Falle des Scheiterns Ihrer Bemühungen noch tun können.
- Vermeiden Sie Überversorgung, Überbehütung und Entmündigung. Fordern Sie die Flüchtlinge auf, soviel wie möglich selbst zu tun.
Sieht jemand grundlegende Rechte aller schwerwiegend verletzt und veranschlagt diese höher als eine grenzte Verletzung der staatlichen Ordnung, so muß er bereit sein, die rechtlichen Konsequenzen zu tragen. Es handelt sich dabei nicht um Widerstand, sondern um demonstrative, zeichenhafte Handlungen, die bis zu Rechtsverstößen gehen können. Die Ernsthaftigkeit und Herausforderung, die in solchen Verstößen liegt, kann nicht einfach durch Hinweis auf die Legalität und Legitimität des parlamentarischen Regierungssystems und seiner Mehrheitsentscheidungen abgetan werden. Zum freiheitlichen Charakter einer Demokratie gehört es, daß die Gewissensentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger gewürdigt und geachtet werden. Auch wenn sie rechtswidrig sind und den dafür vorgesehenen Sanktionen unterliegen, müssen sie als Anfragen an Inhalt und Form demokratischer Entscheidungen ernst genommen werden.
- Es ist möglich, daß Sie sich von den aufgenommenen Flüchtlingen enttäuscht fühlen. Richten Sie sich darauf ein, daß die Flüchtlinge auf Ihre Hilfsangebote anders reagieren können, als Sie es von ihnen erwarten. Ihre Erwartungen sollten Sie den Flüchtlingen gegenüber deutlich machen.
- Grundsätzlich ist damit zurechnen, daß mit dem Ablauf einer Duldung die Sozialhilfeansprüche wegfallen.
- Sie sollten bei den Mitteln, die Sie den Flüchtlingen zur Verfügung stellen, auf eine Gleichbehandlung mit den anderen Flüchtlingen achten.
- Zahlen Sie nach Möglichkeit eine feste Summe regelmäßig aus. Lassen Sie die Flüchtlinge selbständig wirtschaften.
- Bitten Sie andere Gemeinden und Spender, Sie finanziell bei der Versorgung der Flüchtlinge zu unterstützen.
- Prüfen Sie zusammen mit einer Beratungsstelle, ob noch Ansprüche auf Krankenbehandlung bestehen.
- Falls keine Ansprüche auf Krankenbehandlung bestehen, sprechen Sie Ärzte in Ihrer Gemeinde oder Ihnen bekannte Ärzte an. Erkundigen Sie sich bei den Beratungsstellen nach Ärzten, die in solchen Fällen beraten und helfen können.
- Für die Flüchtlingskinder besteht Schulpflicht. Wenn möglich, sollten Sie dafür sorgen, daß die Kinder die bisherige Schule weiter besuchen. Andernfalls versuchen Sie, die Kinder in einer Schule anzumelden. Unter Umständen können kleinere Kinder in kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen aufgenommen werden.
4.4 Konsequenzen des Kirchenasyls
Ebenso wie über Ziel und organisatorische Durchführung sollte sich die Gemeinde über die möglichen Konsequenzen ihres Kirchenasyls im klaren sein. Die Konsequenzen sind natürlich nicht „planbar“. Mit einer vorausschauenden Planung der Aktion können jedoch Reaktionen und Folgen auf das eigene Handeln bedacht und mögliche Gegenstrategien entwickelt werden.
5. Nachbereitung
Wie es auch immer endet, die Gemeinde sollte sich mit dem Ergebnis ihres Kirchenasyls gründlich befassen.
Nicht selten, selbst bei Mißerfolg, hat sich in der Gemeinde eine Dynamik und Aktivität entwickelt, die spürbar positive Impulse in das gesamte Gemeindeleben gebracht hat: Gemeindemitglieder, von denen man es nicht erwartet hätte, haben sich beteiligt und solidarisch erklärt. Es wird zunehmend deutlich, Flüchtlingsarbeit und Flüchtlingssolidarität wird künftig immer mehr ein Bestandteil des sozialen Engagements unserer Gemeinden werden.
Bei negativem Verlauf der Aktion kann sich bei den aktiv Beteiligten Frustration ausbreiten, die die weitere Flüchtlingsarbeit der Gemeinde gefährdet. Dies muß aufgearbeitet und nach Möglichkeit von anderen Gemeindemitgliedern aufgefangen werden. Kritik an möglicherweise falschem Vorgehen darf nicht zur „Demontage“ der sich redlich Mühenden führen.
Anlage zu
3. Rechtliche Aspekte des Kirchenasyls
„Der Pfarrer wie alle Kirchenmitglieder und die Kirche insgesamt können sich auf den Schutz des Artikels 4 Grundgesetz berufen („Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Freiheit, des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzbar. „).
Art. 4, Abs. 1 Grundgesetz hat die Integrität des persönlichen im Glauben begründeten Gewissens zum Bestandteil staatlichen Rechtsschutzes gemacht. Auch das Handeln nach diesem Glauben gehört in den Schutz bereich des Art. 4 GG. „Das Recht des einzelnen, sein gesamtes Verhalten an den Lehren des Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln, ist Teil der grundrechtlich geschützten Glaubensfreiheit“ (Prof. Dr. Gerhard Robbers in einem Aufsatz „Kirchliches Asylrecht?“ i. d. Zeitschrift Archiv d. öffentl. Rechts, Tübingen 1988, S. 44).
Zur Straffolge: „Das Grundrecht der Gewissensfreiheit ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch wertentscheidende Grundsatznorm, die bei der Staatstätigkeit jeder Art, auch bei der Strafzumessung, Wertmaßstäbe setzende Kraft entfaltet. Es besteht daher von Verfassung wegen ein Wohlwollensgebot gegenüber Gewissenstätern. Dies gilt in nicht anderer Weise auch für das Handeln aus Glaubensgründen“ (Gerhard Robbers, a.a.O. S. 46). „Die Gewährung von Kirchenasyl wird relativ häufig strafrechtlich relevant sein. Werden Personen beherbergt, die nach dem Ausländerrecht abgeschoben werden sollen, kommt besonders Beihilfe zu einem Vergehen nach § 47, Abs. 1 Nr. 5, AuslG (1965), (§ 92 AuslG neue Fassung) in Betracht oder eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 93 AuslG n.F. in Verbindung mit § 14 OWIG. Bietet das Kirchenasyl Schutz vor Strafverfolgung, so kann Strafvereitelung gemäß § 258 StGB gegeben sein. Die religiös und gewissensbegründete Handlungsweise der Beteiligten kann hier wegen des verfassungsrechtlich bestehenden Wohlwollensgebotes zu einer Minderung der Schuld führen…“
Anlage zu
4. Fragen zum Kirchenasyl
- Um welche Flüchtlinge (aus welchem Land/aus welchen Ländern) handelt es sich? Sind ausreichende Informationen vorhanden?
- Verschaffen Sie sich einen Eindruck über die Gründe der angedrohten Abschiebung und über die Folgen für die Hilfesuchenden (Gefahr für Freiheit, Leib oder Leben, Trennung von der Familie, Zerstörung bereits erfolgter Integration hier etc.). Sie sollten die Überzeugung gewinnen, daß Sie aus christlich-ethischen, aus rechtlichen oder aus anderen wichtigen Gründen den Flüchtlingen helfen müssen.
- Prüfen Sie zunächst mit dem Rechtsanwalt/der Rechtsanwältin der Flüchtlinge und/oder mit einer Beratungsstelle, ob eine Aufnahme nötig ist. Es besteht akute Gefahr, wenn die Flüchtlinge Meldebescheinigungen mit dem Stempelaufdruck „Flugticket vorlegen“ besitzen.
- Sind alle Rechtsmittel und andere, ähnliche Möglichkeiten (Petitionen, Gespräche mit Behörden, Ministerien, Parlamentariern und sonstigen einflußreichen Persönlichkeiten) ausgeschöpft worden? Gibt es Aktionsformen und alternative Maßnahmen, die anstelle des Kirchenasyls möglicherweise ebenfalls zum Ziel führen können (z. B. Unterschriftensammlungen, Fürbitten und Mahnwachen, gezielte Öffentlichkeitsarbeit und ähnliches)?
- Wenn es keine Alternativen zur kirchlichen Schutzgewährung gibt: sind die Fakten und Argumente, die zu diesem Schritt der Gemeinde führen, plausibel in der Öffentlichkeit vertretbar?
- Rechtfertigen die Umstände des Einzelfalls das „Mittel Kirchenasyl“? Hier sind besonders die Fragen nach dem Vertrauen und der Glaubwürdigkeit zu stellen.
- Prüfen Sie, welche räumlichen, zeitlichen, finanziellen und personellen Mittel Sie haben und mobilisieren können. Wenden Sie sich gegebenenfalls an andere Gemeinden zur Unterstützung.
- Sprechen Sie mit den Flüchtlingen, ob diese die Belastungen einer Aufnahme mit ungewissem Ausgang tragen können. Die Flüchtlinge sollten wissen, daß Sie zu helfen bereit sind, aber nicht für den Erfolg garantieren können.
Anlage zu
4.1 Ziel des Kirchenasyls
- Wird ein dauerhaftes Bleiberecht für die geschützten Flüchtlinge gefordert, oder soll die Abschiebung vorübergehend ausgesetzt werden?
- Wird den Behörden vorgeworfen, den bisherigen Sachverhalt nicht gründlich genug geprüft bzw. nicht die richtigen Konsequenzen gezogen zu haben, oder haben sich in dem vorliegenden Fall grundsätzlich neue Aspekte ergeben, die aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht mehr geprüft werden konnten, gleichwohl eine Abschiebung nicht rechtfertigen? Handelt es sich bei den zu schützenden Flüchtlingen um besondere Einzelfälle, bei denen wegen der besonderen, individuellen Voraussetzungen eine diese Umstände zu berücksichtigende Behördenentscheidung erwartet wird, oder ist die gesamte Gruppe (z. B. Roma, Kurden), aus der die zu schützenden Flüchtlinge stammen, gefährdet?
- Soll die Gewährung von Kirchenasyl als symbolische Aktion erfolgen, oder soll tatsächlich ein effektiver Schutz vor dem zu erwartenden Behördeneingriff erreicht werden?
Beiträge dieser Information entstammen u. a. aus: Sonderheft Publik Forum „Kirchenasyl“/Sonderheft Kirche aktuell „Asyl in der Kirche“/Sonderheft Pax Christi „Flüchtlinge und Fremde“ .
Material- und Informationsdienst für ökumenische Ausländerarbeit Nr. 10/92 (stark gekürzt)
Literaturhinweis: Wolf-Dieter Just (Hg.), Asyl von unten; Kirchenasyl und ziviler Ungehorsam ein Ratgeber, rororo aktuell, Juni 1993