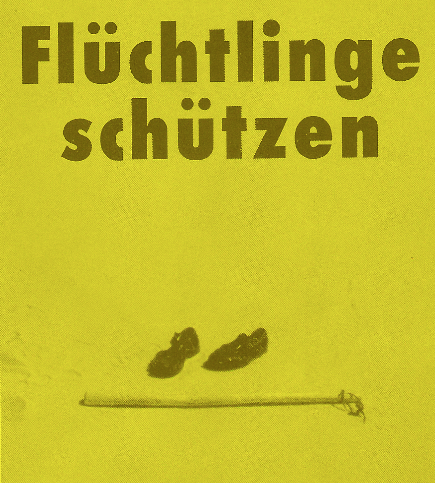TAG DES FLÜCHTLINGS 1992
Jugoslawien
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
- Warum sind Menschen auf der Flucht?
- Türkei
- Iran
- Afghanistan
- Sri Lanka
- Somalia
- Jugoslawien
- Rumänien
- Zwischenbilanz zum Thema Europa und Asylrecht
- Hetze, Missbrauch, Angst und Mitleid
- Was Sie tun können?
- Auszeichnung für PRO ASYL
Während alle Welt auf den Krieg im ehemaligen Vielvölkerstaat Jugoslawien blickt und um eine umfassende politische Lösung des Konflikts auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts sowie der Menschen- und Minderheitenrechte verhandelt wird, gerät die Lage der ethnischen Albaner im Kosovo ins Abseits des öffentlichen Interesses. Doch der Konflikt um die Autonomiebestrebungen der Albaner und die Hegemonieansprüche der Serben im Kosovo ist eskaliert.
Im Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Jugoslawien (Stand 15.12.1991) heißt es: „Der Konflikt zwischen Serben und Albanern im Kosovo hat zu einer extremen Polarisierung zwischen diesen beiden Volksgruppen geführt. Es hat zur Folge, daß im selben Maße, in dem serbische Behörden die politischen Forderungen der Kosovo Albaner bekämpfen, die Gefahr staatlicher Willkür gegenüber ethnischen Albanern allein aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit wächst. „
Die nationalistisch ausgerichtete Politik der serbischen Regierung richtet sich jedoch nicht nur gegen Albaner im Kosovo, sondern auch gegen die Roma. Diese solidarisieren sich in ihrer Mehrheit mit den Forderungen der Albaner.
Im ehemaligen Staat Jugoslawien leben ungefähr 1,8 Millionen ethnische Albaner (7,7% der gesamten Bevölkerung), die zum überwiegenden Teil der muslimischen Glaubensgemeinschaft angehören. Sie bilden die fünftgrößte Volksgruppe im ehemaligen Vielvölkerstaat, zählen jedoch nicht zu den sechs offiziell anerkannten „Nationen“, denen bislang der Status einer Teilrepublik zuerkannt ist. Ihr Hauptsiedlungsgebiet ist das im Süden des Landes gelegene Kosovo, dem Verfassungsstatus nach bis 1990 eine „autonome“ Provinz der Republik Serbien. Hier leben etwa 1,3 Millionen Albaner, die mit einem Anteil von 77,5 % der Bevölkerung die Mehrheit der Provinz bilden. Innerhalb Jugoslawiens gilt das Kosovo als besonders benachteiligtes „Armenhaus“. Die vorwiegend dörflich-ländlich strukturierte Provinz verzeichnet ein Pro-Kopf-Einkommen, das viermal so niedrig ist wie der Durchschnitt in dem früheren Vielvölkerstaat. Die Arbeitslosenrate liegt dagegen viermal so hoch.
Geschichte des Konflikts
Zum Teil erklärt sich die soziale Sprengkraft des serbisch-albanischen Konflikts aus der starken emotionalen Bindung beider Volksgruppen an das Kosovo. So gilt im serbischen historischen Bewußtsein das Kosovo als das Kerngebiet des mittelalterlichen serbischen Reiches, das im 14. Jahrhundert seine größte Ausdehnung erreichte. Nach dieser Auffassung waren Serben die ursprünglichen Einwohner des Gebietes, die erst nach der Eroberung durch die Türken (1389 Schlacht auf dem Amselfeld im Kosovo) allmählich abgewandert seien, so daß in der späteren Besiedlung durch die Albaner ein Akt der „Invasion“ gesehen wird. Demgegenüber wird aus albanischer Sicht angeführt, daß die Albaner die Nachfolger der illyrischen Urbevölkerung des Kosovo seien, die im frühen Mittelalter von slawischen Einwanderern assimiliert wurden. Es wird auch auf ihre (von den Serben bestrittene) aktive Rolle im jahrhundertelangen Unabhängigkeitskampf gegen die türkische Vorherrschaft verwiesen. [… ]
Bereits in dem 1918 gegründeten „Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen“ […] sah sich die albanische Bevölkerung einer massiven Unterdrückung ausgesetzt. […] Den Albanern wurden nicht nur kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten verwehrt – das Albanische war als Amts- und Schulsprache verboten -, sie waren zudem durch willkürliche gewaltsame serbische Obergriffe gegen Einzelpersonen und ganze Dorfgemeinschaften unmittelbar bedroht. Darüber hinaus wurden sie zum Opfer einer organisierten Vertreibungspolitik, die das Ziel einer Ansiedlung serbischer und montenegrinischer Bauern verfolgte.
Nach Beendigung des zweiten Weltkriegs und der Neugründung des jugoslawischen Staates änderte sich an der grundsätzlichen Lage der Kosovo-Albaner nur wenig. Einerseits erhielten sie zwar den verfassungsrechtlichen Status einer anerkannten ethnischen Minderheit, mit dem innerhalb der „Föderativen Volksrepublik Jugoslawien“ der Schutz ihrer kulturellen Eigenständigkeit (einschließlich des Rechts auf albanisch-sprachige Schulen) garantiert wurde. Andererseits verblieb die Provinz Kosovo auch weiterhin unter serbischer Hegemonie. […]
Zudem wurden die Kosovo-Albaner in den politischen Konflikt zwischen Albanien und Jugoslawien hineingezogen, der 1948 als eine Folge des Bruchs zwischen Stalin und Tito ausbrach. Dieses allgemeine Mißtrauen bereitete den Boden für den Aufbau eines Unterdrückungsapparates, der unter dem jugoslawischen Innenminister Aleksandar Rankovic von der serbischen Geheimpolizei gegen die albanische Minderheit eingesetzt wurde. Während der Rankovic-Ara (1947-1966) waren die Kosovo-Albaner einer systematischen Verfolgung ausgesetzt. Menschen verschwanden spurlos oder wurden in Gefängnissen zu Tode gefoltert. Tausende Familien wurden aus dem Kosovo in die Türkei zwangsumgesiedelt.
Nach der Absetzung von Rankovic setzte eine Phase der verhaltenen Liberalisierung ein, die für die Lage der Kosovo-Albaner einige Verbesserungen brachte. Dazu gehörten etwa die Zulassung albanisch-sprachiger Zeitungen und Radiosender, die Übernahme der albanischen Rechtschreibung sowie die Einführung der Bezeichnung Albani statt des abwertenden Siptari. Die 1974 verabschiedete neue Verfassung Jugoslawiens brachte eine Aufwertung des Autonomiestatus und der politischen Beteiligungsrechte der Kosovo-Albaner im Bund und in der Republik. Gleichwohl konnten diese Neuerungen keine dauerhafte Beilegung des Konflikts herbeiführen. […]
Im Frühjahr 1981 formierte sich erstmals seit der jugoslawischen Staatsgründung unter den im Kosovo lebenden Albanern eine breite Oppositionsbewegung, die mit der Forderung nach Gleichberechtigung im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben an die Öffentlichkeit trat. Die von den Demonstranten erhobenen Forderungen zielten zum weit überwiegenden Teil auf die Anerkennung eines eigenen Republikstatus für die Provinz Kosovo. Die serbischen Sicherheitskräfte reagierten mit dem Einsatz massiver Gewalt; es kam zu schweren, mehrere Tage anhaltenden Unruhen. Am 2. April 1981 verhängte die Regierung in Belgrad den Ausnahmezustand über die gesamte Provinz, der mehrere Wochen in Kraft blieb. Während dieser Zeit war das Militär ständig präsent. Es gab zahlreiche Verhaftungen. Für in- und ausländische Journalisten wurde ein Einreiseverbot verfügt. Über die Zahl der Toten und Verletzten liegen nur ungenaue Angaben vor.
Politische Situation im Kosovo
Die Konflikte im Kosovo eskalierten im Frühjahr 1989 vor dem Hintergrund, daß Slobodan Milosevic, der Führer der serbischen KP, die Forderung nach einer „einheitlichen Republik Serbien“ erhob, in der die Autonomierechte der angeschlossenen Provinzen zugunsten der Zentralgewalt aufgehoben werden sollten.
Als im Februar 1989 das Zentralkomitee der jugoslawischen Kommunisten den albanischen Parteisekretär des Kosovo, Azem Vlasi, seines Amtes enthob, traten albanische Bergarbeiter der Mine „Trepca“ in den Hungerstreik und lösten damit einen Generalstreik aus. Die serbische Regierung antwortete mit Massenentlassungen von Tausenden albanischer Arbeiter und stationierte im Kosovo Verfügungstruppen des Innenministeriums. Nach schweren Zusammenstößen zwischen demonstrierenden Albanern und serbischen Ordnungskräften riefen Anfang Juli 1990 albanische Delegierte des Kosovo-Parlaments die Republik Kosovo aus. Daraufhin verfügte das serbische Parlament die Auflösung des Provinz-Parlaments und suspendierte die dortige Regierung. Damit wurde die zuvor bereits eingeschränkte Autonomie der Provinz außer Kraft gesetzt. Als deutliches Zeichen nach außen wurde am 20. März 1991 der Vertreter des Kosovo auch im kollektiven Staatspräsidium durch einen Abgeordneten des serbischen Parlaments „ersetzt“.
Staatliche Repression
Das im Kosovo noch gültige jugoslawische Strafgesetzbuch ermöglicht ein häufig willkürliches Vorgehen der Behörden. So werden Berichten von Amnesty International zufolge die Paragraphen 133 („feindliche Propaganda“), 114 („Konterrevolutionäre Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung“) und 136 („Vereinigung zum Zweck feindlicher Aktivitäten“) angewendet. Auf diese Weise wird nahezu jede Form der politischen Meinungsäußerung, die sich gegen die serbische Regierung wendet, unterdrückt und kriminalisiert.
Die Meinungsfreiheit wurde durch die von Serbien verhängte Kontrolle der albanisch-sprachigen Massenmedien quasi außer Kraft gesetzt; Streiks und Protestaktionen versucht die serbische Regierung mittels eines massiven Polizeiaufgebots und der Verhängung von Ausgangssperren und Versammlungsverboten zu unterdrücken.
Zur Täuschung der europäischen Öffentlichkeit bedient sich die serbische Politik Methoden wie die der sogenannten „administrativen Haft“ und der „Inhaftierung durch Schnellverfahren“. So berichten Mitglieder einer Delegation der Fraktion DIE GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen und vom Bielefelder Flüchtlingsrat, die im Juni 1991 im Kosovo waren, daß „Tausende von Albanern“ zu 30 bis 60 Tagen Haft verurteilt und anschließend sofort ins Gefängnis gesteckt wurden.
Die Gesundheitsversorgung der Kosovo-Albaner wurde drastisch eingeschränkt; albanisches Ärzte- und Pflegepersonal wurde entlassen. Klinikaufenthalte und Medikamente können kaum bezahlt werden. Die Maßnahmen im Gesundheitssystem richten sich vor allem auch gegen die gynäkologischen Kliniken, um die höhe Geburtsrate der Albaner zu reduzieren.
Auch die Arbeit der albanischen politischen Parteien wird von der serbischen Regierung schwer behindert; es wurden nur zwei albanische politische Parteien zugelassen.
Das politische Klima heizte sich durch die serbische Regierung derart auf, daß es immer wieder zu Ermordungen von Albanern – manchmal sogar Kindern – durch die serbische Polizei oder sogar serbische Dorfnachbarn kommt. Vorfälle wie die bestialische Ermordung des 11jährigen Jungen Afrim Prebreza in Bellagevci im Mai 1991 häufen sich. Mit der Bewaffnung serbischer Zivilisten im Kosovo hat der Konflikt seit Mitte Mai 1991 eine neue, explosive Dimension bekommen.
Flüchtlinge aus dem Kosovo in der Bundesrepublik
Die Verhältnisse im Kosovo führten dazu, daß in den letzten drei Jahren zunehmend mehr Kosovo-Albaner und Roma nach Westeuropa und in die Bundesrepublik flohen. Ihre Asylanträge hatten in der Vergangenheit in der Bundesrepublik jedoch kaum eine Chance.
Auch wenn man berücksichtigt, daß die hohe Zahl der jugoslawischen Antragsteller – im Jahr 1991 immerhin 29,2 Prozent aller gestellten Asylanträge – vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs zustande kommt, zeigt die geringe Anerkennungsquote von 2,0 Prozent doch, daß insbesondere auch Flüchtlinge aus dem Kosovo nicht als politisch verfolgt anerkannt werden.
Die Gerichte beriefen sich auf eine angebliche „inländische Fluchtalternative“ in Slowenien und prüften daher die Verfolgung „in Kosovo“ nicht weiter. Ein Abschiebeschutz für Flüchtlinge aus dem Kosovo ist angesichts der aktuellen Lage besonders dringlich. Denn nach den Autonomieerklärungen der Republiken Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina stellt sich auch die Frage einer Fluchtalternative im „Staatsverband“ Jugoslawien nicht mehr.
Die Kosovo-Albaner geraten hinter dem blutigen Krieg in Kroatien in Vergessenheit. Die Autonomie-Bestrebungen der albanischen Bevölkerung in der serbischen Provinz werden von Belgrad rücksichtslos unterdrückt.
Gewerkschafter aus Kosovo berichten in Frankfurt am Main auf Einladung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) über den neuesten Schachzug Belgrads: Die Aussperrung der albanischen Schüler vom Unterricht. Vergangene Woche forderte der Schulstreit die beiden ersten Todesopfer.
Beim Versuch, privaten Unterricht in einem Wohnhaus im Dorf Uce bei Istog abzuhalten, habe die serbische Polizei das Haus umzingelt, schildert Agim Hyseni, Präsident der „Unabhängigen Gewerkschaft für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Republik Kosovo“, den blutigen Vorfall. Die Polizei habe die Schüler zur Wache mitnehmen wollen. Der Hausbesitzer des Privathauses habe der Polizei klargemacht, daß man hier keine Unruhe stiften, sondern nur Ersatz für mangelnden Unterricht schaffen wolle.
„Die Polizei hat sofort geschossen“, sagt Hyseni, ein 63 und ein 61 Jahre alter Vater seien getötet worden, ein Schüler und vier weitere Eltern schwer verletzt worden. Die Polizei habe sich auf Notwehr berufen, angeblich seien Steine geflogen. Am Tag der Todesschüsse sollte ein Gespräch mit dem serbischen Schulminister stattfinden, das dann nicht mehr zustande kam – eine gezielte Provokation, vermutet die Gewerkschaft. Das Dorf ist Hysenis Angaben zufolge seitdem völlig von der Außenwelt abgeschnitten, „keiner darf mehr rein, keiner raus“.
Etwa 500.000 albanische Schülerinnen und Schüler, schätzt die Gewerkschaft, erhalten derzeit keinen Unterricht. Fast alle albanischen Lehrkräfte seien inzwischen entlassen, zuletzt auf einen Schlag 6.000 am 1. September 1991. Belgrad will serbische Unterrichtspläne durchsetzen, was der Schilderung der Gewerkschafter zufolge zu so absurden Situationen führt, daß beispielsweise in der Kleinstadt Uvicitern eine für 2.000 Schüler ausgelegte Schule derzeit Unterricht „für einen einzigen serbischen Schüler macht“. Die serbischen Lehrpläne leugnen die nationale Identität der Kosovo-Albaner.
Schülern über 17 Jahre, die von der Polizei festgenommen werden, droht die sofortige Einberufung in die jugoslawische Bundesarmee; sie würden vor allem in den Kampfgebieten an vorderster Front eingesetzt, berichtet Hyseni. Gewalttätige Zwischenfälle wie in Uce gibt es nach den Erkenntnissen der Gewerkschaften fast täglich, zwischen 1981 und 1991 seien 62 Minderjährige bei Protesten gegen die serbische Unterdrückung getötet worden. Die Kosovo-Albaner würden nicht offen drangsaliert; Lehrer erhielten kein offizielles Entlassungsschreiben, würden vielmehr einfach nicht mehr in die Schulen gelassen. „Die Kosovo-Albaner sind rechtlos, es hat wenig Sinn, sich an Gerichte zu wenden“, meint Hyseni. 1991 seien etwa 40.000 der insgesamt zwei Millionen Kosovo-Albaner vorübergehend oder dauerhaft festgenommen worden.
Auch an der Universität von Kosovo in Pristina seien viele albanische Dozenten entlassen worden; in anderen wichtigen Berufsgruppen, etwa bei Ärzten, würden mehr und mehr Albaner vor die Tür gesetzt. Viele Kosovo-Albaner leben in bitterer Armut, berichtet Hyseni, „mehrere Kinder sind schon verhungert“. Krankheiten, die in WestEuropa kaum mehr auftreten, wie etwa TBC, häuften sich in Kosovo.
„Serbien muß durch diplomatischen und wirtschaftlichen Druck von außen gezwungen werden, die Menschenrechtskonvention, die es selbst unterschrieben hat, einzuhalten“, fordert der Gewerkschaftspräsident. In einem im geheimen abgehaltenen Referendum haben sich die Kosovo-Albaner kürzlich für eine unabhängige, souveräne Republik Kosovo entschieden. Serbien wird seinen Griff freilich kaum lockern. Für Hyseni steht fest, „daß wir mit Serbien auf keinen Fall mehr zusammenleben können“.
aus: Frankfurter Rundschau, 8.2.1992
Quellen und weiterführende Literatur:
Lagebericht Jugoslawien (Stand 15.2.1991) des Auswärtigen Amtes, Bonn (514-516.80/3), in:
ID Asyl, Nr. 52. Bezug: ID Asyl, Obere Holtener Str. 28, 4100 Duisburg 11
Jürgen Feldhoff, Flucht ins Asyl, AJZ Verlag, Bielefeld 1991
Bielefelder Flüchtlingsrat: Repression und Verfolgung in Kosovo/Jugoslawien. Bericht über eine Delegationsreise v. 16.-20.6.1991 Bezug: Bielefelder Flüchtlingsrat, Teutoburger Str. 106, 4800 Bremen 1
Flüchtlingsrat NRW: Lustig ist das Zigeunerleben? Warum die Roma für ihr BleibeRecht kämpfen. Bezug: Worringer Str. 70, 4000 Düsseldorf
Karin Reemtsma: Roma in Jugoslawien, Report im Auftrag der Gesellschaft für bedrohte Völker, ZDWF-Schriftenreihe Nr. 37. Bezug: ZDWF, Hans-Böckler-Str. 3, 5300 Bonn 3