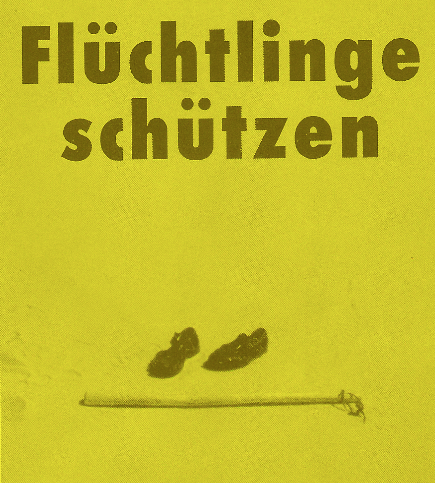TAG DES FLÜCHTLINGS 1992
Hetze, Missbrauch, Angst und Mitleid
Heribert Prantl
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
- Warum sind Menschen auf der Flucht?
- Türkei
- Iran
- Afghanistan
- Sri Lanka
- Somalia
- Jugoslawien
- Rumänien
- Zwischenbilanz zum Thema Europa und Asylrecht
- Hetze, Missbrauch, Angst und Mitleid
- Was Sie tun können?
- Auszeichnung für PRO ASYL
Die Flüchtlingsorganisation PRO ASYL versuchte zu erklären, warum Menschen fliehen: „Wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ist humanes Leben nicht mehr möglich. Und so suchen Flüchtlinge, die zu uns kommen, weniger den goldenen Westen als vielmehr Schutz.“ Diese Sätze stammen aus einer Anzeige, mit der um Unterstützung für Flüchtlinge warb. Und das war die Reaktion: „Das Gute an ihnen ist ja, daß man sie leichter erkennt als damals, vor 50 Jahren, Juden. Die Asiaten, Neger Südländer werden uns nicht durch die Lappen gehen. Die Anzeigenkampagne hatte um Hilfe gebeten. Die Antwort war wenig Geld und viel Haß.
Eine immer bedrohlichere Atmosphäre entsteht: Humanität gerät zum Schimpfwort, „Humanitätsduselei“ ist noch das mildeste. Wer für Hilfe und Schutz wirbt, wird ausgelacht. Wer ein Grundrecht erhalten will, wird beschimpft. Wer Flüchtlinge Schmarotzer nennt, kann mit großen Sympathien rechnen. Gestern wurde verschämt getuschelt, heute wird immer radikaler gefordert: Kurzen Prozeß machen, raus mit ihnen, Ende. Asylgesetze, die man 1980 als extrem empfand, gelten als lasch. Über den Artikel 16 Absatz 2 Grundgesetz wird geredet, als sei dies der Name für einen Virus. Man tut so, als gebe es ein verseuchtes Zimmer im Haus der deutschen Verfassung. Nach der Grundgesetzänderung wird daher gerufen wie nach dem Kammerjäger.
Flucht von Goslar nach London
Die Fehler der Sozial- und Wohnungsbaupolitik werden einem Sündenbock aufgeladen: Die Asylbewerber sind schuld. 6.800 Menschen sollen also, zum Beispiel, schuld sein an der Wohnungsmisere der Millionenstadt München. Geschürte Angst entlädt sich in Leserbriefen, in Hoyerswerda und in der Berliner S-Bahn. Soeben haben die Briten einen Flüchtling aus dem Sudan aufgenommen, der aus Angst vor weiteren Angriffen von Goslar nach London geflohen war. Recht so, werden viele sagen, die beim Wort Asyl nur noch an Mißbrauch denken können. Schlecht so – im Ausland leben die Vorurteile vom häßlichen Deutschen wieder auf. Die öffentliche Meinung im Inland schwankt derweil zwischen Hetze und Mitleid: Flüchtlinge als solche sind schlecht, mag es auch im Einzelfall anders sein. In den Zorn über ihre stets steigenden Zahlen und in die Angst um den eigenen Wohlstand mischen sich ab und zu Tränen der Rührung über ein verbranntes Ausländerkind. So etwas darf nicht sein, sagt man dann. Andererseits könne es aber auch „nicht ständig so weiter gehen mit dem Asyl“.
Die Flüchtlingsdebatte kennt keine neuen Argumente, verkrampft klammert sie sich an einen Grundgesetzartikel. In bezeichnend deutscher Manier sucht sie die Lösung eines Problems in der Veränderung von Paragraphen. Alle Argumente sind wieder und wieder durchgekaut. Es gibt keine neuen Positionen, es gibt keine neue Bewegung. Was in der letzten Woche als Bewegung in der SPD vermeldet wurde, war der bekannte Tanz der Genossen: Die einen drehen.sich links herum, die anderen drehen sich rechts herum. Da gibt es auch einige, denen die Beine eingeschlafen sind. Und, wenn diese Genossen dann sehen, daß eine Kamera an der Tanzfläche steht, dann beginnen auch sie wieder zu tanzen – mit dem gleichen Schritt wie schon ein paar Wochen und ein paar Monate vorher, genauso wie immer, wenn diese Melodie gespielt wird.
Der Münchner Oberbürgermeister hat bei Gott nichts Sensationelles gesagt in seinem Spiegel-Interview am Rosenmontag. Sein Satz, daß eine Grundgesetzänderung kein Tabu sein könne, findet in dieser Allgemeinheit sofort eine Zweidrittel-Mehrheit. Nicht die Aussage als solche, sondern ihre bunte Verpackung war das Besondere. Mit ihr konnte sich immerhin die CSU für den Aschermittwoch schmücken.
Die Asyldiskussion der letzten Woche hat sich in dieser Form schon unzählige Male abgespielt, besonders exzessiv im letzten Sommer. Sie dreht sich wie ein Karussell, einmal schnell, einmal langsam, aber immer auf der Stelle. Ein einziges Mal stand das Karussell still, im Herbst, als die Flüchtlingsheime brannten. Doch das Trauerjahr für Verbrechen an Ausländern dauert nur eine Woche. Die belegte Stimme der Politik hat deshalb längst wieder die alte Schärfe gewonnen. Und der Artikel 16 Grundgesetz wird behandelt wie ein Stück Seife, das sich durch häufige Benutzung verbraucht.
Asylgnade vor Asylrecht?
Wie soll es weitergehen? Soll man den Artikel 16 opfern? Ist das der Preis für das Ende des Streits? Muß man ihn zahlen, damit wieder Ruhe einkehrt? Vielleicht ist mittlerweile der Schaden, den die endlose Diskussion um die Grundgesetzänderung angerichtet hat, schon schlimmer, als es eine Änderung selbst je gewesen wäre. Könnte man mit dem zerknüllten Gesetzpapier wenigstens jenen Radikalen den Mund stopfen, die sich aufführen, als schriebe man das Jahr 1933? Ist eine solche Hoffnung, wie sie viele Parlamentarier der Unionsparteien hegen mögen, realistisch? Und was sagt man der Bevölkerung, wenn sie eines Tages merkt, daß die Grundgesetzänderung nichts gebracht hat? Welche Maßnahmen folgen dann?
Eine bloße Änderung des Grundrechts hat keinerlei Effekt. Solange Asylgewährung überhaupt ein Grundrecht bleibt, muß über jeden Asylantrag in einem individuellen Verfahren entschieden werden. Dies bedeutet: Jeder einzelne Fall wird einzeln untersucht. Wer dies für überflüssigen Luxus hält, der muß Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 ersatzlos streichen und das Asyl zu einem Gnadenakt ausgestalten. Auch Gnade freilich bedeutet nicht Willkür; auch sie müßte den Ansprüchen des Rechtsstaats Genüge tun. Und ob die Zahl der Flüchtlinge, die Asylgnade wollen, wirklich so viel geringer wäre als die Zahl derer, die jetzt Asylrecht begehren? Vor allem aber ist zu beachten: Wenn Artikel 16 fällt, dann steht die Genfer Flüchtlingskonvention auf; sie spielt bisher in der deutschen Asylpraxis eine nur marginale Rolle. Wird Artikel 16 also gestrichen, dann tauchen alle Probleme, die mit der Verwaltung des bisherigen Asylgrundrechts zusammenhängen, erneut auf – dann müssen nämlich die völkerrechtlichen Pflichten der Flüchtlingskonvention erfüllt werden. Wenn diese Probleme europaweit geklärt, wenn einheitliche Standards bei der Auslegung und Anwendung der Flüchtlingskonvention gefunden sind, dann kann man über Artikel 16 reden. Bis dahin ist es aber noch ein mühsamer Weg. Die gemeinsamen Standards kann man nicht auf dem Abfallplatz suchen.
Das ist kein Plädoyer für Fatalismus, sondern ein Appell an die Seriosität der Politik in Deutschland. Natürlich lassen sich Asylverfahren beschleunigen – vor allem durch praktische Verwaltungsmaßnahmen. Dies gelingt freilich nur dann, wenn die Parteien aufhören, das Gelingen oder Mißlingen angeblich gemeinsamer Pläne nach wahltaktischen Gesichtspunkten zu steuern. Im übrigen kommt es nicht nur darauf an, die Entwicklungshilfe zu erhöhen. Es gilt, der Bevölkerung zu sagen, daß Fluchtbewegungen nicht durch Knopfdruck ausgeschaltet werden können. Wenn die Parteien solche Hoffnungen wecken, schaden sie sich selbst. Die Ernte fremdenfeindlicher Politik fahren die radikalen Parteien in die Scheuer.