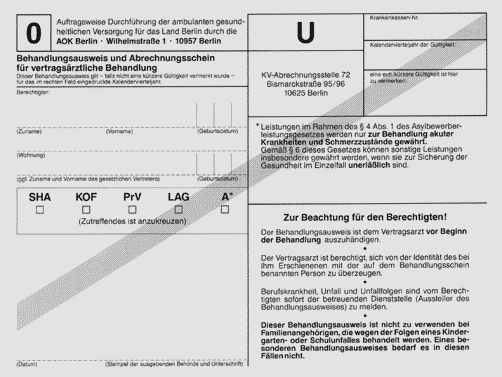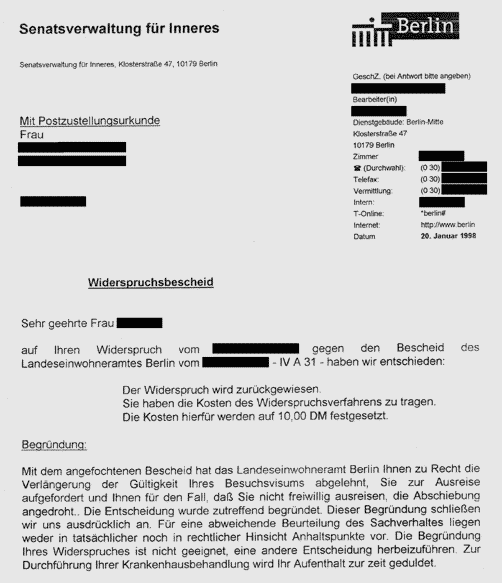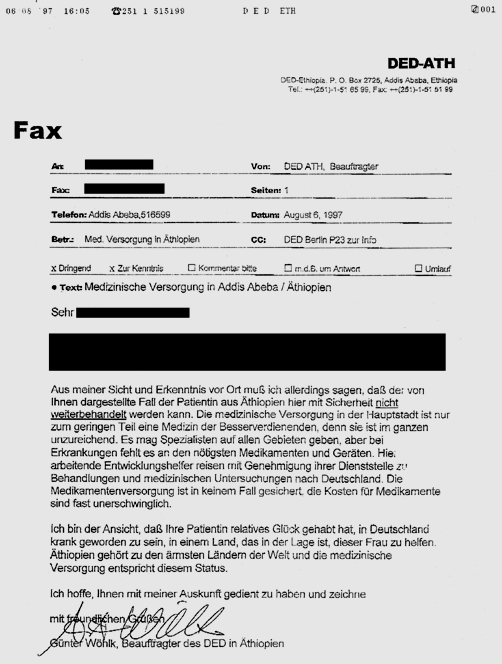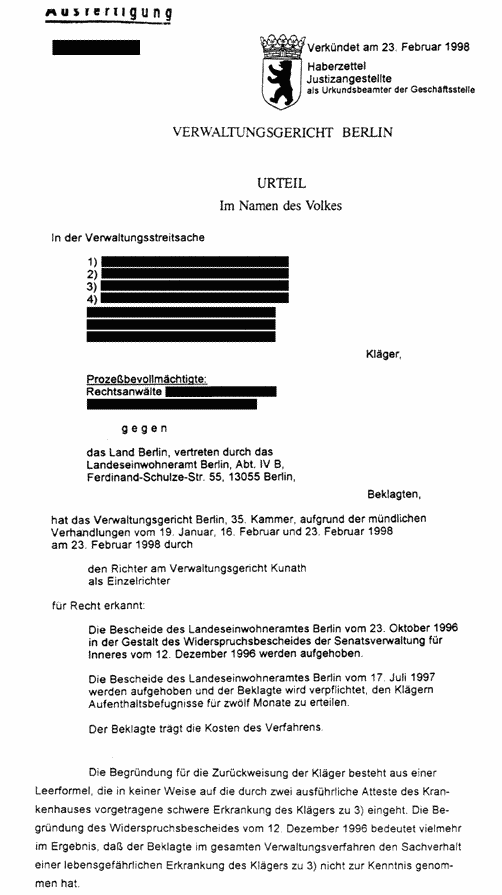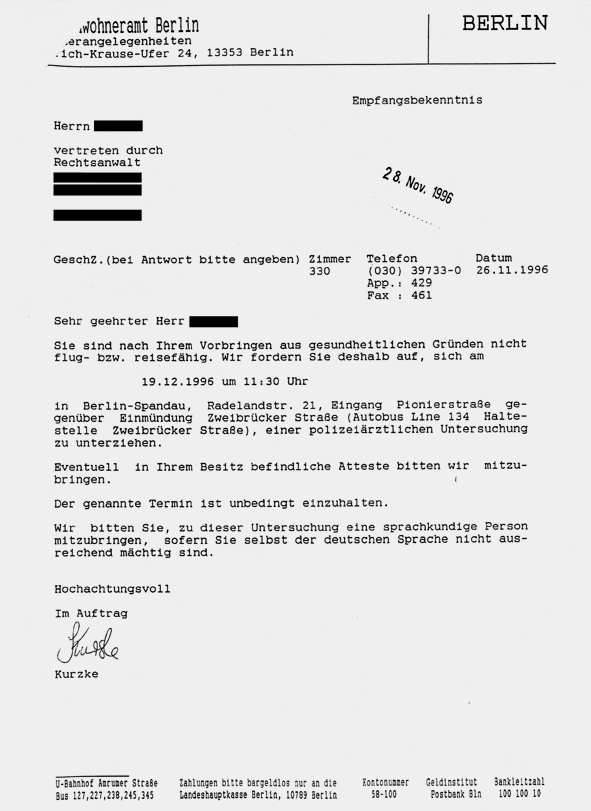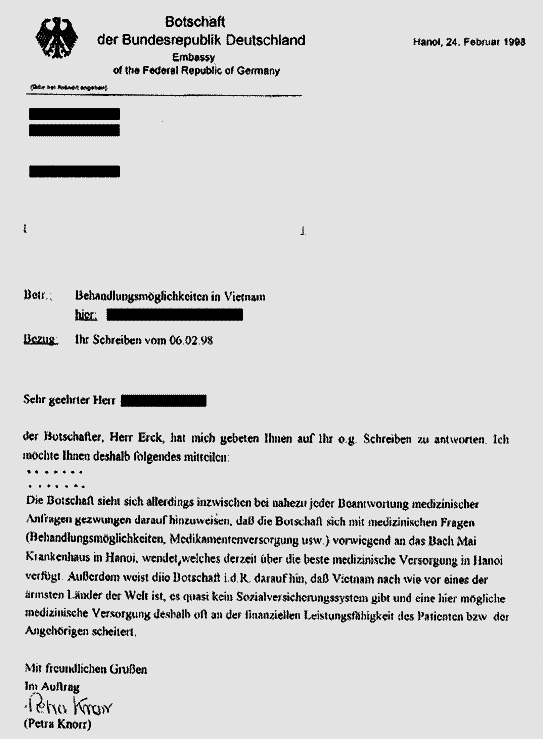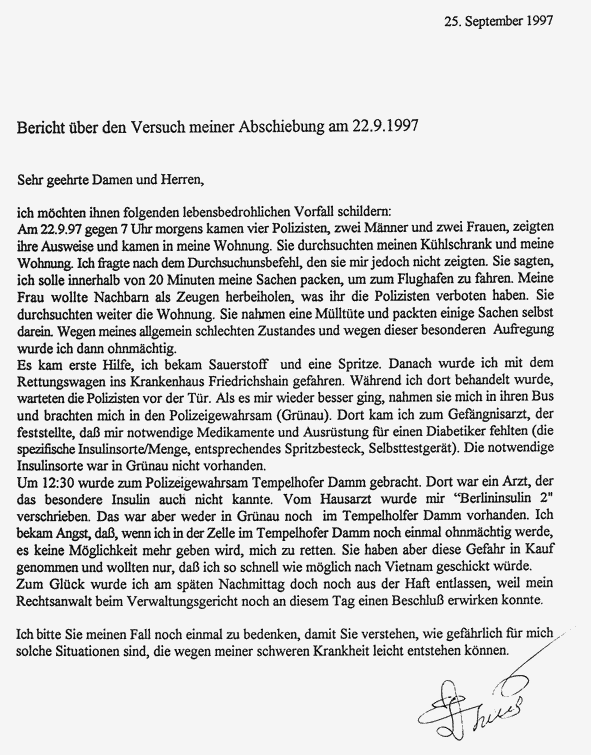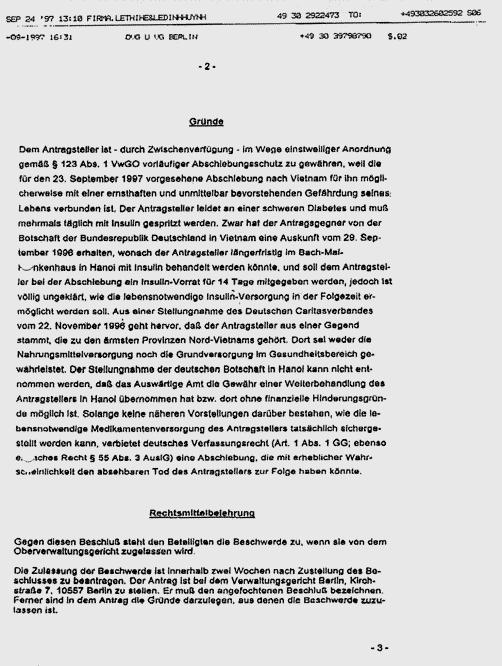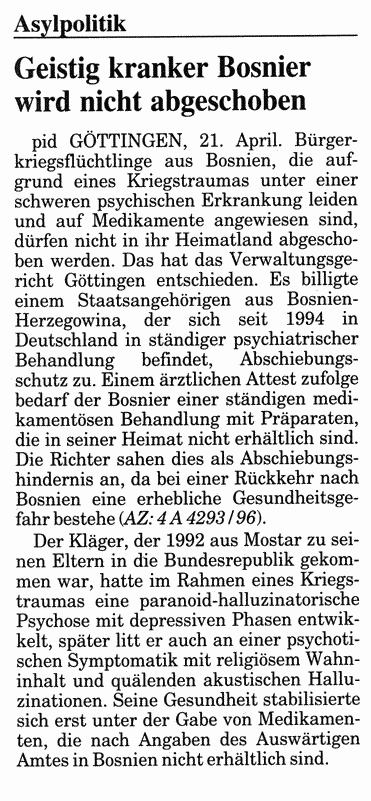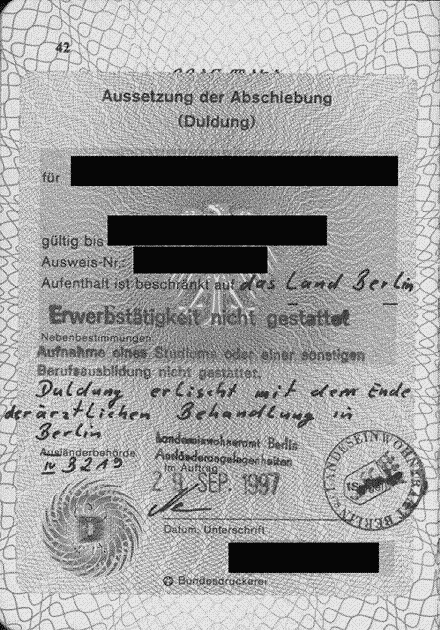Flüchtlingsrat Berlin
Ärztekammer Berlin
Pro Asyl Förderverein Pro Asyl e.V.
Gefesselte Medizin
Ärztliches Handeln –
abhängig von Aufenthaltsrechten?
Eine Handreichung
Zum Geleit
1. Einleitung
2. Medizinische Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
2.1 Gesetzliche Grundlagen
2.1.1 Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen
2.1.1.1 Asylbewerber
2.1.1.2 Asylberechtigte; Aufenthaltsbefugnis
2.1.1.3 Bürgerkriegsflüchtlinge und andere Flüchtlinge mit Duldung
2.1.1.4 „Vollziehbar Ausreisepflichtige“
2.1.1.5 Aufenthalt mit räumlicher Beschränkung
2.1.1.6 Ausländer ohne Aufenthaltsrecht
2.1.2 Sozialrechtliche Bestimmungen
2.1.2.1 Krankenversicherung und Unfallversicherung
2.1.2.1.1 Gesetzliche Krankenversicherung
2.1.2.1.2 Familienversicherung
2.1.2.1.3 Krankenversicherung im Ausland
2.1.2.1.4 Private Auslandskrankenversicherung
2.1.2.1.5 Unfallversicherung
2.1.2.2 Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
2.1.2.2.1 Allgemeine Bestimmungen
2.1.2.2.2 Einschränkung der Sozialhilfe für Ausländer
2.1.2.2.3 „Um-zu-Regelung“
2.1.2.3 Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
2.1.2.3.1 Entstehung; 1. Fassung von 1993
2.1.2.3.2 Ausweitung 1997
2.1.2.3.3 Einschränkungen der medizinische Versorgung
2.1.2.3.4 Die Abgrenzung chronischer und akuter Erkrankungen
2.1.2.3.5 Die Berliner Ausführungsvorschrift des AsylbLG
2.1.2.3.6 Medizinische Versorgung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht nach AsylbLG
2.1.2.3.7 Medizinische Versorgung außerhalb der räumlichen Beschränkung
2.1.2.3.8 Erneute Verschärfung des AsylbLG 1998
2.2 Ambulante medizinische Versorgung von Ausländern mit gesetzlichem Anspruch
2.2.1 Niedergelassene Ärzte, Sicherstellungsauftrag
2.2.1.1 Krankenscheine
2.2.1.1.1 Zuständigkeiten der Ausstellung von Krankenscheinen
2.2.1.1.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
2.2.1.1.3 Voraussetzungen für die Ausstellung von Krankenscheinen
2.2.1.1.4 Mögliche Konsequenzen für Patient und Arzt
2.2.1.1.5 Ausstellung eines Zweitkrankenscheines
2.2.1.1.6 Ausstellung eines Krankenscheines durch eine Behörde außerhalb Berlins
2.2.1.2 Daten und Datenmißbrauch auf Krankenscheinen
2.2.1.3 Verordnung von Medikamenten – Regreß
2.2.1.4 Sprachmittlung
2.2.2 Krankenhausambulanzen – Rettungsstellen – Notdienste
2.3 Stationäre medizinische Versorgung von Ausländern mit gesetzlichem Anspruch
2.3.1 Einweisungen
2.3.1.1 Amtsärztliche Überprüfung von Einweisungen
2.3.2 Stationäre Aufnahme
2.3.2.1 Notfall
2.3.2.2 Schwangerschaft – Entbindung – Schwangerschaftsabbruch
2.4 Medizinische Versorgung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht versus „Illegale“
2.4.1 Definition des Begriffs „Illegaler Ausländer“
2.4.2 Ethische Erwägungen zur ärztlichen Versorgung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht
2.4.3 Ambulante medizinische Versorgung
2.4.3.1 Niedergelassene Ärzte
2.4.3.1.1 Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe – Netzwerk
2.4.3.2 Arztmobil der Caritas
2.4.3.3 Bahnhofsambulanz
2.4.3.4 Krankenhausambulanzen – Rettungsstellen – Notdienst
2.4.4 Stationäre medizinische Versorgung
2.4.4.1 Stationäre Aufnahme
2.4.4.1.1 Notfälle
2.4.4.1.2 Schwangerschaft – Entbindung – Schwangerschaftsabbruch
2.4.5 Krankheit „schafft“ Aufenthaltsrecht
2.4.6 Kostenübernahme
2.4.6.1 Sozialamt
2.4.6.2 Defizite der Krankenhäuser durch nicht erfolgte Kostenübernahme
2.5 Meldepflicht von Personaldaten
3. Begutachtungen, Atteste
3.1 Gründe für Attestierungen
3.1.1 Kostenübernahme
3.1.1.2 Atteste und Stellungnahmen für eine Behandlung außerhalb des Zuteilungsbezirks
3.1.1.3 Atteste für medizinisch indizierte Hilfsmittel
3.1.1.4 Atteste für Diätzulagen
3.1.1.5 Atteste für den Wechsel aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine Wohnung
3.1.2 Reise- und Flugfähigkeit
3.2 Aufbau von Attesten und ärztlichen Stellungnahmen
3.3 Überprüfung von Attesten
3.3.1 Überprüfung durch den polizeiärztlichen Dienst
3.3.2 Überprüfung durch Amtsärzte oder andere Ärzte
3.3.3 Zunehmende Beeinflussung medizinischer Belange durch Behörden
4. Abschiebungshaft
4.1 Medizinische Versorgung
4.1.1 Polizelärztucher Dienst, angestellte Ärztin, Sanitäter
4.1.2 Externe Ärzte
4.1.3 Stationäre Behandlung
4.2 Beurteilung von Haftunfähigkeit, Reiseunfähigkeit, Flugunfähigkeit
4.3 Sprachmittler
4.4 Beirat für den Abschiebungsgewahrsam – Auszüge aus einem Bericht an den Innensenat
4.5 „Initiative gegen Abschiebehaft“
5. Abschiebung
5.1 Letzte lnterventionsmöglichkeiten bei Abschiebungen Kranker
5.1.1 Flughafensozialdienst Berlin-Schönefeld
5.1.2 Flughafenarzt
6. Gremium für ausländerrechtliche Härtefälle
6.1 ungewöhnliche Einblicke
7. Thesen
8. Ausblicke
9. Interkulturelles Gesundheitszentrum für Berlin
10. Textnachweise
11. Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
12. Adressen
RESSOURCEN
Herausgeber
Dokumente
Die erneute Verschärfung des Asylbewerberleistungsgesetzes 1998
Zum Geleit
Die Probleme der unter uns lebenden Asylbewerber, Flüchtlinge und Menschen ohne deutschen Paß sind in den letzten Wochen wieder verstärkt in die öffentliche Diskussion geraten. Eine erneute Verschärfung des Asylbewerberleistungsgesetzes steht im Bundestag zur Entscheidung an. Sollte sie in der vorliegenden Fassung beschlossen werden, schränkt dies für eine große Zahl von Menschen nicht nur die Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern auch die Hilfe bei Krankheit massiv ein.
In dieser Situation ist es wichtig, die rechtlichen Bestimmungen zur medizinischen Versorgung der Asylsuchenden und Flüchtlinge und die Verwaltungspraxis der Behörden bei der Bewilligung oder Ablehnung der Kostenübernahme für bestimmte medizinische Leistungen genau zu kennen. Der hier vorliegenden Broschüre, die der Flüchtlingsrat Berlin zusammen mit der Ärztekammer Berlin und Pro Asyl herausgibt, kommt das Verdienst zu, alle diese Fragen in einer sachlichen und an praktischen Beispielen orientierten Form darzustellen. Für Ärztinnen und Ärzte sind Handlungsalternativen sichtbar. Außerdem werden die Arbeit der unterschiedlichen Projekte und Angebote im Bereich der medizinischen Versorgung vorgestellt. Die Handreichung leistet einen wichtigen Beitrag, alltägliche Situationen im Umgang mit Flüchtlingen richtig einzuschätzen und nicht nur ethisch korrekt, sondern auch möglichst effektiv zugunsten der betroffenen Patienten handeln zu können. Gleichzeitig schafft dieses „Lehrbuch der Flüchtlingsmedizin“ den kritischen Blick für menschenunwürdige Verhältnisse in unserem Land, die wir nicht tatenlos hinnehmen dürfen. Dafür bin ich den Autoren besonders dankbar. „Gefesselte Medizin“ dokumentiert, daß in Berlin Ärztinnen und Ärzte und viele couragierte Menschen für humane Grundwerte einstehen und das soziale Gewissen der Medizin verteidigen. Dies macht Hoffnung für zukünftig bessere Verhältnisse trotz der gegenwärtigen Not und Unterdrückung.
Dr. med. Ellis Huber
Präsident der Ärztekammer Berlin
Einleitung
Weniges wird in unserer Gesellschaft kontroverser diskutiert als Migration, deren Ursachen und Folgen. Ob Flucht aus politischer, religiöser oder ethnischer Verfolgung geschieht, aus geschlechtsspezifischen Gründen, sexueller Orientierung oder als Folge zerstörter finanzieller oder ökologischer Lebensgrundlagen – stets sind es Ereignisse, die Menschen in ihrer Existenz bedrohen. Wenn die geflüchteten Menschen aber erst einmal bei uns sind – mit oder ohne staatlich sanktioniertem Aufenthaltsstatus – ist unsere Gesellschaft in der Pflicht, ihnen existentielle Hilfe und Rechte zu gewähren. Sonst würden wir uns dem Vorwurf aussetzen, Werte zu opfern, die unsere Gesellschaft in besonderer Weise geprägt haben.
Diesen Werten kann ein christliches, humanistisches oder sozialistisches Verständnis zugrundeliegen; gemeinsam ist ihnen das Prinzip der Solidarität, des Füreinander, der Option für die – aus welchen Gründen auch immer – migrierten Menschen.
Geben wir dies auf, droht uns die Barbarei. Es gibt viele Anzeichen dafür, daß sich unsere Gesellschaft heute in diese Richtung bewegt. Wir sollten hierüber nicht klagen, sondern all‘ unsere Energie aufbieten, um dagegenzuhalten.
Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten werden immer mehr lebensbestimmende Rechte vorenthalten – ob bei uns oder in anderen europäischen Ländern, während viele außereuropäische Staaten weit größeren Belastungen durch Migrationsbewegungen ausgesetzt sind als wir. Trotz allem soll unser Augenmerk aber unserem Land, unserer Stadt, gelten.
Seit 1982 hat der Flüchtlingsrat Berlin die Entwicklung der medizinischen Versorgung dieser Personen in Berlin aufmerksam registriert. Durch seine Interventionen konnten Teilaspekte dieser Entwicklung entschärft werden.
Mit dieser Broschüre, die die Arbeitsgruppe Medizin und Soziales des Flüchtlingsrates – in Kooperation mit der Ärztekammer Berlin und der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge Pro Asyl und der Stiftung Umverteilen – erarbeitet hat, soll eine Situationsbeschreibung der gegenwärtigen Verhältnisse vorgenommen werden. Die Verantwortung für die Wertungen, die unverzichtbar waren, liegt bei den einzelnen Autoren. Die „Thesen“ und „Ausblicke“ am Ende der Handreichung sind Ergebnisse der Diskussionsprozesse innerhalb des Flüchtlingsrates, zu dessen Arbeitskreis Medizin auch die Mehrzahl der Autorinnen und Autoren gehört.
Abgesehen von den wenigen berlinspezifischen Passagen könnten die einzelnen Beiträge auch bundesweit für die im Medizinbereich Tätigen Anregungen für ihr Wirken zugunsten migrierter Patienten vermitteln. Wenn damit auch Impulse, zumindest auf lokalpolitischer Ebene, gegeben würden, um die Lebensbedingungen der Schutzsuchenden zu verbessern, käme dies dem Ziel der Autorinnen und Autoren noch näher.
Sie hoffen, daß auch im medizinischen Bereich zunehmend kritisch nachgefragt, Stellung bezogen und für die Lebensrechte von Migranten agiert wird.
Dafür ist es höchste Zeit!
Dem Folgenden möchte ich ein Zitat Kurt Tucholskys voranschicken, das heute nicht weniger zutreffend ist als in der Zeit, in der es geschrieben wurde (1932):
Es ist ein Charakteristikum des Maschinenzeitalters, daß die meisten Menschen glauben, etwas Gutes geleistet zu haben, wenn sie etwas geleistet haben. Sind die Regeln erfüllt, so sind alle befriedigt.
Der Arzt hat operiert; der Richter hat termingemäß ein Urteil gefällt; der Beamte hat das Gesuch geprüft – sie haben das Reglementmäßige getan. Was dabei herauskommt, ist ihnen völlig gleichgültig.
„Das ist nicht mehr meine Sache…”
Da keiner die Gesamtwirkung der kleinen Teilarbeiten übersieht
und sie auch nicht übersehen will, so bleibt die Gesamtwirkung
nur auf einem haften: auf dem Erleidenden.
Die anderen haben ihre Pflicht getan.
Eberhard Vorbrodt
Allen, die für das Zustandekommen der Broschüre einen Beitrag geleistet haben, sei herzlich gedankt.
Die Autorinnen und Autoren der einzelnen Beiträge zeichnen mit ihren Namenkürzeln; dazu notwendige Erörterungen finden Sie am Ende der Handreichung.
In den folgenden Ausführungen werden, trotz besserer Einsicht und der Gefahr, damit Kontroversen auszulösen, die Personen einfachheitshalber nur in maskuliner Form benannt.
2. Medizinische Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
2.1 Gesetzliche Grundlagen
(1) (UM) Die rechtlichen Ansprüche auf medizinische Versorgung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Ausländern ohne Aufenthaltsrecht richten sich nach unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften. Entscheidend sind zunächst die Bestimmungen des Ausländer- (AuslG) und des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG), aus denen sich der Aufenthaltsstatus eines Ausländers ergibt.
Von diesem Status hängt ab, welche sozialrechtlichen Bestimmungen gelten. Diese werden daher erst im Anschluß unter (2.2.) behandelt.
2.1.1 Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen
2.1.1.1 Asylbewerber
(2) Menschen, die in Deutschland aufgrund von politischer Verfolgung in ihrem Herkunftsland einen Asylantrag stellen, fallen unter Artikel 16a des Grundgesetzes.
Die lapidare Formulierung „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht” wurde durch die Reform von 1993 allerdings fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt:
(3) Alle Nachbarstaaten Deutschlands gelten jetzt als sichere Drittstaaten: Wer nachweislich über einen von diesen nach Deutschland einreist, hat hier keinen Anspruch mehr auf die Durchführung eines Asylverfahrens. (1)
(4) Wer aus einem „sicheren Herkunftsstaat” (2) kommt, dessen Antrag wird als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Über Flughäfen einreisende Flüchtlinge werden im sogenannten Flughafenverfahren zunächst an der Einreise gehindert, bis über ihr Asylbegehren im Eilverfahren entschieden ist. (3)
(5) Fazit: Nur illegal eingereiste, die sich in die Hände von Schleppern begeben haben, haben überhaupt eine Chance auf ein reguläres Asylverfahren. Ihnen haftet selbst bereits der Ruch des Kriminellen an, z.B. wenn sie von der Polizei ergriffen werden, bevor sie einen Asylantrag stellen konnten.
Dennoch gelingt es immer noch zwischen 8.000 bis 10.000 Menschen im Monat, nach Deutschland zu kommen und einen Asylantrag zu stellen.
(6) Das Asylverfahren wird vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFL) durchgeführt, das in jeder Region eine Zweigstelle hat und auch Sammelunterkünfte bereithält, in denen die Flüchtlinge während ihres Verfahrens – zumindest in den ersten drei Monaten – wohnen müssen. (4)
In Berlin befindet sich die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZAA) in Spandau, Streitstraße. (5)
(7) Wird ein Asylantrag abgelehnt, gibt es die Möglichkeit für eine Klage beim Verwaltungsgericht. Der Betroffene bleibt für die ganze Zeit Asylbewerber und erhält von der Ausländerbehörde eine Aufenthaltsgestattung, die alle sechs Monate verlängert wird.
Ein Asylverfahren kann sich – trotz der Beschleunigung der Bearbeitung seit 1993 – auch heute noch über mehrere Jahre hinziehen.
2.1.1.2 Asylberechtigte; Aufenthaltsbefugnis
(8) Wenn ein Flüchtling als Asylberechtigter nach Art. 16 des Grundgesetzes anerkannt wird, erhält er eine Aufenthaltserlaubnis (6) und genießt damit dieselben Rechte wie die in Deutschland lebenden ausländischen Arbeitnehmer und ihre Familien.
(9) Einem Asylbewerber kann auch unter Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention6 Abschiebeschutz gewährt werden. In diesem Fall erhält er eine zunächst auf zwei Jahre befristete Aufenthaltsbefugnis (7), die allerdings weniger Rechte gewährt.
In beiden Fällen ist er vor Ausweisung und Abschiebung relativ sicher.
(10) Eine Aufenthaltsbefugnis (mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr) kann auch aus dringenden humanitären Gründen wie z.B. wegen einer schweren, im Herkunftsland nicht behandelbaren Krankheit erteilt werden, oder wenn ein Flüchtling über zwei Jahre ununterbrochen Inhaber einer Duldung war (vgl. 2.1.1.3), oder wenn ihm im Rahmen einer sogenannten Altfallregelung nach einem langjährigem Aufenthalt die oberste Landesbehörde ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewährt. (8)
2.1.1.3 Bürgerkriegsflüchtlinge und andere
Flüchtlinge mit Duldung
(11) Als im Jahr 1992 viele Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland kamen, beschlossen die Innenminister der Länder, für diese Gruppe einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus zu ermöglichen, um ihnen den Weg ins Asylverfahren zu ersparen.
Die nach dem Ausländergesetz mögliche Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis wurde aber nur in den seltensten Fällen gewährt, vorherrschend blieb die Vergabe von Duldungen, die in der Regel alle sechs Monate verlängert wurden.
(12) Eine Duldung9 erhalten auch Asylbewerber, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden können. Zu den rechtlichen Gründen10 gehören die konkrete Gefahr von Folter, unmenschlicher Behandlung im Widerspruch zur europäischen Menschenrechtskonvention und Gefahren für Leib und Leben, die zum Beispiel auch dann gegeben sind, wenn die medizinische Versorgung im Herkunftsland nicht sichergestellt ist. Zu den tatsächlichen Gründen für die Erteilung der Duldung gehört, daß eine Abschiebung praktisch nicht durchführbar ist, z. B. bei Reiseunfähigkeit oder bei einer Verweigerung der Einreise durch das Herkunftsland, oder bei fehlendem Paß.
Faktisch bedeutet jedoch die Duldung nur die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung.
2.1.1.4 „Vollziehbar Ausreisepflichtige“
(13) Neben den genannten drei Aufenthaltstiteln: Aufenthaltsgestattung, Aufenthaltsbefugnis bzw. Aufenthaltserlaubnis und Duldung, die vom Ausländergesetz klar geregelt sind, gibt es keinen legalen Aufenthaltsstatus für Flüchtlinge.
Wer sich dennoch in Deutschland aufhält, gilt als „vollziehbar ausreisepflichtig“ und kann jederzeit in Abschiebungshaft genommen oder direkt abgeschoben werden.
(14) Dennoch leben in Berlin immer noch Tausende Menschen, denen die Polizei nach Ablauf ihrer Duldung nur noch eine sogenannte „Melde-” oder „Grenzübertrittsbescheinigung” (GRÜB) ausstellt.
In diesen Papieren wird die Identität des Betroffenen bescheinigt und bestätigt, daß er zu einem bestimmten Termin entweder wieder bei der Ausländerbehörde vorsprechen oder aus Deutschland ausreisen müsse. Auch wenn z. B. der Ausreisetermin längst verstrichen ist, gilt die Grenzübertrittsbescheinigung quasi als Aufenthaltstitel.
(15) Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil vom 25.9.1997 klargestellt, daß solche Verfahren nicht rechtmäßig sind: Entweder die Abschiebung ist möglich und kann daher auch durchgeführt werden, oder sie ist es nicht: dann ist umgehend eine Duldung zu erteilen.
(16) Die Berliner Ausländerbehörde verfährt in der Erteilung von Duldungen mittlerweile entsprechend.
(17) Gleichzeitig startete das Land Berlin eine Bundesratsinitiative, um das Ausländergesetz entsprechend zu ändern, damit die jahrelang von den Behördern praktizierte, nunmehr für rechtswidrig erklärte, Praxis dennoch fortgeführt werden kann – nun auf einer neuen gesetzlichen Grundlage.
2.1.1.5 Aufenthalt mit räumlicher Beschränkung
(18) Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber und Duldungen werden nur für einen bestimmten Verwaltungsbezirk ausgestellt, in dem sie gültig sind. (11) Die Inhaber unterliegen damit einer Aufenthaltsbeschränkung. Nur mit behördlicher Genehmigung dürfen sie in andere Gebiete reisen. Wenn Sie sich dennoch außerhalb des betreffenden Gebietes aufhalten, können Sie festgenommen und dorthin zurückgebracht werden, wo ihr einzig legaler Aufenthaltsort ist.
(19) Sie haben wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein Bußgeldverfahren und im Wiederholungsfall ein Strafverfahren zu erwarten. Diese finden auch Eingang in die Kriminalitätsstatistik und tragen zur allgemeinen Kriminalisierung der Ausländer bei.
(20) Der Sinn der Aufenthaltsbeschränkung liegt im Verteilungsverfahren der Asylbewerber begründet. Danach ist jedes Bundesland nur verpflichtet, eine bestimmte Quote aller Asylbewerber aufzunehmen. Wird diese überschritten, werden die Bewerber gleich nach der Antragsstellung in ein anderes Bundesland verteilt. Dies gilt insbesondere für Berlin, wo immer viel mehr Menschen Asyl beantragten, als nach der Quote (2,2%) aufgenommen werden mußten.
(21) Das System der räumlichen Beschränkung erlangte traurige Berühmtheit, als Opfer von Brandanschlägen und rechtsextremen Übergriffen auf Wohnheime von Asylbewerbern in anderen Regionen der Bundesrepublik Schutz suchten, aber in die gefährdeten Gebiete zurückkehren mußten, weil nur dort ihr Aufenthalt „legal“ war.
2.1.1.6 Ausländer ohne Aufenthaltsrecht
(22) Es gibt auch in Berlin eine wachsende Zahl von Ausländern, die aus den unterschiedlichsten Gründen überhaupt keinen Aufenthaltsstatus, auch keinen der behördlich bescheinigten Illegalität, mehr haben: Asylbewerber und Geduldete, die sich nach Ablauf ihres Aufenthalts der Abschiebung durch „Untertauchen” entzogen haben; Ausländer, die nach Ablauf ihres Touristenvisums im Land geblieben sind oder die ohne Genehmigung eingereist sind und nie versucht haben, einen Aufenthaltsstatus zu erhalten. Auch diese Personen gelten als „vollziehbar Ausreisepflichtige“.
Ihnen droht bei Ergreifen Abschiebungshaft und ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts. (12)
2.1.2 Sozialrechtliche Bestimmungen
2.1.2.1 Krankenversicherung und Unfallversicherung
2.1.2.1.1 Gesetzliche Krankenversicherung
(23) Der häufigste Fall, über den die medizinische Versorgung der Patienten finanziert wird, ist die gesetzliche Krankenversicherung. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist eine der folgenden Bedingungen:
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigung,
- Bezug von Arbeitslosenleistungen oder Rente,
- Studium,
- Mitgliedschaft eines Familienmitglieds.
(24) Diese Bedingungen sind für den Personenkreis, von dem die Broschüre vor allem handelt, nur sehr selten zu erfüllen, weil entweder ein explizites Verbot von Arbeit oder Studium besteht (bei Asylbewerbern) oder nur eine allgemeine Arbeitserlaubnis erteilt wird, die an einen konkreten Arbeitsplatz gebunden ist und nur dann erfolgt, wenn sich für diesen Arbeitsplatz kein anderer bevorrechtigter Bewerber, ein Deutscher, ein EG-Bürger oder ein Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis, findet (sogenanntes Inländerprimat).
(25) Selbst Asylberechtigte haben keinen Anspruch auf die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse, solange sie noch keine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufgenommen haben.
2.1.2.1.2 Familienversicherung
(26) Ehegatten und Kinder von hier arbeitenden und krankenversicherten Ausländern können nur dann in die Krankenversicherung aufgenommen werden, wenn sie einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben (aber nicht als Touristen) und selbst über kein oder nur ein geringes Einkommen verfügen.
Kinder von Krankenversicherten sind mindestens bis zum 18. Lebensjahr, wenn nicht erwerbstätig bis zum 23. Lebensjahr, bei weiterhin bestehender Schul- und Berufsausbildung bis zum 25. Lebensjahr, in die beitragsfreie Familienversicherung aufzunehmen.
(27) Auch wenn Familienmitglieder eines krankenversicherten Ausländers im Asylverfahren oder Inhaber einer Duldung sind, sind sie nach einem Urteil des Bundessozialgerichtes vom 30.4.199712 in die Familienversicherung aufzunehmen.
2.1.2.1.3 Krankenversicherung im Ausland
(28) Wenn ein Ausländer in seinem Herkunftsland krankenversichert ist, kann er auch in Deutschland Leistungen beanspruchen, sofern zwischen dem Herkunftsland und Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen besteht.
Dies gilt für alle EG-Länder und außerdem für die ehemaligen Anwerbeländer Türkei, Tunesien, Marokko und Jugoslawien.
Letzteres schließt nicht nur die heutige Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), sondern auch die anderen Nachfolgestaaten einschließlich Bosnien und Herzegowina ein.
Auch für geduldete Bürgerkriegsflüchtlinge besteht damit ein Krankenversicherungsanspruch, sofern sie in Bosnien-Herzegowina krankenversichert waren und dies nachweisen können.
(29) Die Leistungen sind allerdings sehr unterschiedlich und hängen von den jeweiligen Regelungen der Sozialversicherungs-abkommen ab.
Bei Polen z. B. besteht nur kostenfreie Behandlung für entsandte Arbeitnehmer; alle anderen müssen sich privat versichern oder die Kosten der Behandlung aus der eigenen Tasche bezahlen. Allerdings gilt grundsätzlich auch für Touristen, daß sie bei Bedürftigkeit Leistungen der Sozialhilfe erhalten können.
2.1.2.1.4 Private Auslandskrankenversicherung
(30) Der Abschluß einer privaten Auslandskrankenversicherung wird empfohlen, wenn es zwischen Deutschland und dem Herkunftsland kein Sozialversicherungsabkommen gibt. Wird aufgrund einer Einladung nach Deutschland ein Touristenvisum für einen Ausländer ausgestellt, muß sich der Gastgeber verpflichten (13) , alle Kosten, auch die der Krankenbehandlung, zu übernehmen, die durch den Aufenthalt seines Gastes entstehen. Auch in diesen Fällen werden daher oft private Auslands-krankenversicherungen – meist über den ADAC – abgeschlossen.
(31) Sowohl den Versicherungsnehmern als auch den potentiell behandelnden Ärzten ist dringend geboten, die Versicherungsbedingungen in allen Einzelheiten zur Kenntnis zu nehmen, um später keine unangenehme Überraschungen zu erleben.
(32) Für eine Vielzahl von Erkrankungen, deren zeitlicher Ursprung vor der Einreise lag, verweigern die Versicherer die – auch nur teilweise – Begleichung der Kosten von Diagnostik und Therapie. Leider betrifft dies auch Karzinom- und andere konsumierende Erkrankungen, die sich erstmals während des Deutschlandaufenthaltes symptomatisch bemerkbar machten, erstrecht natürlich eine Vielzahl chronischer Krankheiten, Kriegsverletzungen und die meisten Zahnerkrankungen.
2.1.2.1.5 Unfallversicherung
(33) Bei Arbeitsunfällen oder Unfällen auf dem Weg zum oder vom Arbeitsplatz greift grundsätzlich die gesetzliche Unfallversicherung, durch die eine kostenfreie Behandlung sichergestellt wird. Für diesen Versicherungsschutz ist der ausländerrechtliche Status des Arbeitnehmers ebenso unerheblich wie der Tatbestand, daß der Arbeitgeber tatsächlich die entsprechenden Beiträge an die Berufsgenossenschaft entrichtet hat; d.h. er greift grundsätzlich auch bei illegaler Beschäftigung.
2.1.2.2 Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
2.1.2.2.1 Allgemeine Bestimmungen
(34) Wer über keine Krankenversicherung verfügt, hat Anspruch auf medizinische Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz.
Die in §37 BSHG aufgeführten medizinischen Leistungen entsprechen dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Nach dem BSHG zur Krankenhilfe berechtigt sind auch Ausländer ohne Krankenversicherung, die eine Aufenthaltsgenehmigung (Aufenthaltsbefugnis und Aufenthaltserlaubnis) besitzen. Für Touristen gelten die in (vergl. 2.1.2.1) genannten Ein-schränkungen.
2.1.2.2.2 Einschränkung der Sozialhilfe für Ausländer
(35) Einschränkungen der Sozialhilfe für Ausländer werden in §120 des BSHG geregelt. Eine medizinische Versorgung wird aber im §120 (1) ausdrücklich als Leistung festgeschrieben, die zu gewähren ist und nicht vom Sachbearbeiter interpretiert werden darf, ebenso die Hilfe zur Pflege und die Hilfe bei Schwangerschaft und Entbindung.
(36) Umstritten ist dagegen schon der Umfang der Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln wie Prothesen, Rollstühlen etc.
So lehnte es 1994 das Oberverwaltungsgericht Münster ab, ein Hörgerät für ein hörbehindertes ausländisches Mädchen zu finanzieren, mit dem Argument, es handele sich hierbei nicht um eine Leistung der Krankenhilfe, sondern der Wiedereingliederungshilfe Behinderter, auf die Ausländer keinen Anspruch haben.
2.1.2.2.3 „Um-zu-Regelung”
(37) Eine weitere Möglichkeit, medizinische Leistungen einzuschränken, gibt der 3. Absatz des §120 BSHG:
„Ausländer, die sich in die Bundesrepublik Deutschland begeben haben, um Sozialhilfe zu erlangen, haben keinen Anspruch. Haben sie sich zum Zwecke der Behandlung oder Linderung einer Krankheit in die Bundesrepublik begeben, soll Krankenhilfe insoweit nur zur Behebung eines akuten lebensbedrohlichen Zustands oder für eine unaufschiebbare und unabweisbar gebotene Behandlung einer schweren oder ansteckenden Erkrankung geleistet werden.“
(38) Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge, deren Aufenthalt in Deutschland geduldet wird, fallen in der Regel nicht unter diese Bestimmung, da ja die politische Verfolgung oder der Krieg sie nach Deutschland getrieben haben.
(39) Doch so einfach das auf den ersten Blick aussieht, so kompliziert kann in einzelnen Fällen, die oft ganze Flüchtlingsgruppen betreffen, die Beamtenlogik zuschlagen:
Waren nicht viele Bürgerkriegsflüchtlinge, die über Österreich und Tschechien eingereist sind, bereits dort vor dem Krieg sicher, und sind sie nicht vielleicht nur deshalb zu ihren Angehörigen nach Deutschland geflohen, um dort Sozialhilfe zu erschleichen? Sind die Palästinenser, denen der Berliner Innensenator Wilhelm Kewenig wegen des Bürgerkriegs im Libanon, dessen Ende 1988 nicht abzusehen war, großzügigerweise ein Aufenthaltsrecht gewährte, nach dem Krieg nicht allein deshalb in Deutschland geblieben, um sich mit Sozialhilfe versorgen zu lassen?
(40) Die sogenannte „um-zu-Regelung“ war schon immer sehr dehnbar und bildete eine wichtige Waffe der Sozialämter bei der Einschränkung auch medizinischer Leistungen.
(41) Eine deutliche Verschärfung der „um-zu-Regelung“ sehen die skandalösen Beschlüsse des Bundesrates vom 6.2.1998 vor, die angeblich nur eine Angleichung der Bestimmungen vom BSHG und AsylbLG vornehmen sollen (vgl. 2.1.2.3.8).
2.1.2.3 Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
2.1.2.3.1 Entstehung; 1. Fassung von 1993
(42) Besonders gravierend sind die Veränderungen, die sich für die Mehrheit der Flüchtlinge seit der Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes am 1. November 1993 vollzogen. Diese Reform war Teil des Asylkompromisses und sollte zusätzlich zu den juristischen Barrieren eine weitere Abschreckungsmauer um Deutschland errichten. Mit ihm wurde die Ausgrenzung bestimmter Personengruppen aus der staatlich garantierten Mindestversorgung für Arme, dem Bundessozialhilfegesetz, in die Wege geleitet.
(43) In der Fassung von 1993 blieb die Anwendung des Asylbewerberleistungsgesetzes noch auf Asylsuchende im ersten Jahr ihres Asylverfahrens und auf „vollziehbar Ausreisepflichtige“ beschränkt.
2.1.2.3.2 Ausweitung 1997
(44) Zum 1. Juni 1997 wurde eine drastische Verschärfung und Ausweitung des Gesetzes beschlossen: die Aufenthaltsdauer, innerhalb derer ein Ausländer nur noch Leistungen nach dem AsylbLG erhält, wurde auf drei Jahre ausgedehnt, und zwar für:
- Asylbewerber,
- Flüchtlinge mit Duldung, auch Bürgerkriegsflüchtlinge,
- Flüchtlinge mit Meldefrist oder Grenzübertrittsbescheinigung (wie bisher).
(45) Eine Klausel legt fest, daß die 3-jährige Absenkung der Leistungen auch für diejenigen Flüchtlinge gilt, die zum Zeitpunkt seines Inkraftretens schon drei Jahre und länger im Land waren.
Es wurden noch nicht einmal bereits vergangene kürzere Aufenthaltszeiten auf die drei Jahre angerechnet. Bis Juni 2000 ist daher der gesamte Personenkreis von den Einschränkungen betroffen – Zeit genug, daß dem Gesetzgeber eine neue Verschärfung einfällt.
2.1.2.3.3 Einschränkungen der medizinischen Versorgung
(46) Das Asylbewerberleistungsgesetz beschränkt in §4 die medizinische Versorgung auf die Behandlung von „akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen”; Zahnersatz wird nur gewährt, soweit dies „aus medizinischen Gründen unaufschiebbar” ist.
Die Versorgung bei chronischen Krankheiten ist also nicht mehr eindeutig geregelt, der Krankenhausaufenthalt nicht mehr explizit aufgeführt.
(47) Der §6 läßt unter „sonstige Leistungen” allerdings noch eine weitergehende medizinische Versorgung (also auch von nicht schmerzhaften chronischen Erkrankungen) zu, „wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit unerläßlich sind”. Was dies für den Umfang der medizinischen Behandlung im einzelnen bedeutet, ist bisher nicht geregelt.
(48) In der Begründung des Gesetzentwurfs wird auf „konkretisierende Empfehlungen” verwiesen, über deren Notwendigkeit mit der Bundesärztekammer Einvernehmen bestehe. Tatsächlich sind solche Empfehlungen nie erarbeitet worden.
(49) Damit blieb es den Bundesländern überlassen, für die Anwendung des Gesetzes Ausführungsvorschriften zu erlassen. In den einzelnenAusführungsvorschriften der Bundesländer finden sich dann liberale wie auch sehr restriktive Auslegungen des Gesetzes. In einigen Streitfällen liegen auch schon Entscheidungen der Verwaltungsgerichte vor.
2.1.2.3.4 Die Abgrenzung chronischer und akuter Erkrankungen
(50) Umstritten ist vor allem die Abgrenzung von akuten und chronischen Krankheiten, die im Grunde nur von einem Arzt selbst getroffen werden kann, nachdem der Patient bereits untersucht wurde. Bei Schmerzen oder längerfristigen Gefahren für Leib und Leben ist grundsätzlich zu behandeln.
(51) Dennoch ist es immer wieder vorgekommen, daß Behörden oder Gerichte für bestimmte Krankheiten keine Behandlungsnotwendigkeit sehen. So wies erst vor kurzem das Verwaltungsgericht Frankfurt/M (14) eine Klage ab, die die Stadt zur Kostenübernahme für eine Lebertransplantation verpflichtet hätte, obwohl durch das Unterlassen dieser Operation Gefahr für Gesundheit und Leben des Asylbewerbers bestand. Erst durch den öffentlichen Druck, den ein Bericht in der Sendung „Monitor” auslöste, revidierte die Behörde (nicht das Gericht!) die Entscheidung
2.1.2.3.5 Die Berliner Ausführungsvorschrift des AsylbLG
(52) In Berlin galt von 1993 bis 1996 eine Ausführungsvorschrift, die ausdrücklich keine Einschränkungen bei der ambulanten medizinischen Behandlung vorsah. Allerdings konnte die Kostenübernahme für bestimmte Leistungen zumindest so lange abgelehnt werden, bis der Betroffene nicht mehr unter die verschärften Einschränkungen fiel.
Wie dies gehandhabt wird, nachdem nun eine Wartezeit von drei Jahren besteht, ist bisher noch nicht bekannt.
(53) Seit 1.11.1996 gibt es keine Ausführungsvorschrift mehr. Deshalb traten bei Ärzten Verunsicherungen auf, welche Leistungen sie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz noch abrechnen können.
Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin hat zwar klargestellt, daß bei der ambulanten Behandlung weiterhin keine Einschränkungen bestehen, allerdings mit dem rechtlich nicht zulässigen Zusatz, wenn diese „für die Sicherung der Gesundheit unerläßlich” seien. (15) Dieser Passus stammt nämlich aus §6 des Gesetzes und bezieht sich auf Leistungen, die über die Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen hinausgehen. Nur für diese gilt also diese Einschränkung.
2.1.2.3.6 Medizinische Versorgung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht nach AsylbLG
(54) Das Asylbewerberleistungsgesetz mit seinem Minimum an medizinischer Versorgung gilt auch für Ausländer, die keinen regulären Aufenthalt in Deutschland haben.
Für den generellen Anspruch auf Sozialhilfe ist nur der tatsächliche Aufenthalt entscheidend, nicht das Vorhandensein eines Aufenthaltstitels, wie es das Berliner Oberverwaltungsgericht schon in einer Entscheidung von 1994 klar gemacht hat.(16)
(55) Nicht nur die Inhaber von Grenzübertrittsbescheinigungen und Meldebescheinigungen (vergl. 2.1.1.4), sondern auch Ausländer ohne jegliche Papiere können (vergl. 2.1.1.6), wenn sie ihre Identität auf irgendeine Weise dokumentieren können, Hilfe nach dem AsylbLG erhalten. (17) Dies gilt auch für Touristen nach Ablauf ihres Visums.
(56) Natürlich impliziert ein solches Hilfegesuchen beim Sozialamt, daß diese Daten an die Ausländerbehörde weitergegeben werden, die dann Maßnahmen zur Abschiebung ergreifen kann. (18)
2.1.2.3.7 Medizinische Versorgung außerhalb der räumlichen Beschränkung
(57) Das Asylbewerberleistungsgesetz regelt auch den Umfang an Hilfen für Menschen, die sich außerhalb der räumlichen Beschränkung aufhalten (vergl. 2.1.1.5).
(58) Hier darf nur eine „nach den Umständen unabweisbar gebotene” medizinische Hilfe, z. B. bei Notaufnahme oder Entbindung, geleistet werden; ansonsten ist der Kostenträger des Gebietes zuständig, für das die Duldung oder Aufenthaltsgestattung ausgestellt ist. Ist ein Aufschub der Behandlung möglich, finanziert das Sozialamt z. B nur die Bundesbahnfahrkarte an den vorgeschriebenen Aufenthaltsort.
(59) Aufgrund dieser Regelung kann z. B. die Ausgabe eines Krankenscheins verweigert werden, obwohl die ambulante Behandlung bei einem niedergelassenen Arzt kostengünstiger als die Inanspruchnahme der Notaufnahme wäre.
2.1.2.3.8 Erneute Verschärfung des AsylbLG 1998?
(60) Die Berliner Landesregierung hat schon im September 1997, also nur drei Monate nach der erheblichen Ausweitung des AsylbLG, eine Bundesratsinitiative gestartet, um auch in das AsylbLG eine „um-zu-Regelung” nach dem Muster des BSHG aufnehmen zu lassen. (19)
Am 6.2.1998 wurde diese im Bundesrat beschlossen und aufgrund von Vorschlägen anderer Bundesländer noch erheblich verschärft. Ein neuer §1a AsylbLG „Anspruchseinschränkung” legt fest, daß Flüchtlinge mit Duldung und „vollziehbar Ausreisepflichtige”…
- „die sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu verlangen, oder
- bei denen aus von ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können, oder
- die nicht freiwillig ausreisen, obwohl ihrer Ausreise in den Herkunftsstaat oder in einen anderen zur Aufnahme bereiten Staat keine rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen…”
nur noch Leistungen erhalten sollen „soweit dies im Einzelfall unabweisbar geboten ist.”
(61) Dadurch würden ca. 250.000 Flüchtlinge, unter ihnen – entgegen anderslautenden Beschwichtigungsversuchen – auch Bürgerkriegsopfer aus Bosnien-Herzegowina, keine Sozialleistungen mehr erhalten; viele wären gezwungen, einen Asylantrag zu stellen, obwohl sie keine Aussichten auf ein erfolgversprechendes Asylverfahren haben; auch Flüchtlinge, die nicht abgeschoben werden können und auch freiwillig keine Möglichkeit zur Rückkehr in das Herkunftsland haben, würden unter dem Druck der Not aus Deutschland vertrieben und müßten wahrscheinlich in europäischen Nachbarländern Zuflucht suchen.
(62) Daß es Überlegungen gibt, die Anwendung dieser Regelung auf bosnische Kriegsflüchtlinge erst 1999 auszudehnen, ist kein Grund zur Beruhigung, sondern weiteres Indiz für eine Taktik der schleichenden Aushöhlung des Sozialstaats, aus dem immer mehr Menschen ausgegrenzt werden. So wie manches, was heute Gesetz geworden ist, zum Zeitpunkt des Asylkompromisses noch „als mit der Verfassung unvereinbar” abgewiesen worden wäre, droht hier eine allmähliche Erosion des Unrechtsbewußtseins angesichts der Verletzung des obersten Verfassungsprinzips, des Schutzes der Menschenwürde.
(63) Daß gerade im Bereich der Flüchtlingspolitik der Weg Deutschlands zu einer Ellbogengesellschaft der sozialen Kälte in solcher Geschwindigkeit beschritten wird, sollte alle, die sich beruflich dem Dienst am Leben verschrieben haben, besonders empören und sie zu Anwälten der Ausgegrenzten werden lassen.
2.2 Ambulante medizinische Versorgung von Ausländern mit gesetzlichem Anspruch
(64) (ev) Nach dem Asylverfahrensgesetz bleibt es den jeweiligen obersten Landesbehörden überlassen, Art und Umfang der Untersuchungen und die durchzuführende ärztliche Stelle zu bestimmen.
So wird in Berlin bei allen Asylsuchenden innerhalb der ersten Woche nach Asylantragstellung eine Röntgenschirmbilduntersuchung auf Tuberkulose durchgeführt. Eine Diagnostik zusätzlicher Infektionskrankheiten findet ebenso wenig statt wie Untersuchungen anderer Organe bzw. eine ärztliche Gesamtbeurteilung des Gesundheitszustandes der Eingereisten.
(65) Sowohl aus organisatorischen als auch finanziellen Gründen sind in den Erstaufnahmestellen und den nachfolgenden Gemeinschaftsunterkünften keinerlei medizinische Anlaufstellen eingerichtet, die sich um eine Primärversorgung dieser Kranken bemühen.
(66) Einerseits widersprächen derartige Einrichtungen dem Gebot der freien Arztwahl und würden, falls deren Besuch – wie in einigen Bundesländern – für die Betroffenen verpflichtend ist, nur wenige Korrekturmöglichkeiten in Diagnostik und Therapie zulassen und die Bewertung und mögliche ärztliche Einflußnahmen auf administrative Entscheidungen der Behörden wesentlich erschweren. Andererseits mangelt es in den Unterkünften eklatant an Sozialarbeitern, die auch bei Kranken betreuend und gegenüber ärztlichen Einrichtungen vermittelnd agieren könnten.
(67) Auf die Vielzahl weiterer schwieriger Probleme, die sich aus dem Interaktionsverhältnis zwischen asylsuchenden Patienten – Arzt – Unterbringung – Beratungsstellen – Behörden – Polizei ergeben, soll hier nicht näher eingegangen werden.
(68) Entscheidend dafür, ob eine ambulante Behandlung überhaupt eingeleitet und evtl. sogar mit Erfolg durchgeführt werden kann, ist die Frage, ob eine sprachliche Kommunikation möglich und die Voraussetzung der Vergütung ärztlicher Leistungen gegeben ist.
2.2.1 Niedergelassene Ärzte, Sicherstellungsauftrag
(69) Ärzte, Zahnärzte und Krankenkassen wirken zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung der Versicherten zusammen.(21) Die Versorgung muß ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein.
(70) Während aufgrund dieses Sicherstellungsauftrags die ärztliche Versorgung aller Krankenversicherten – natürlich auch der ausländischen – gesetzlich geregelt wird, sind keinerlei gesetzliche Regularien für die Versorgung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht („Illegale”) vorhanden.
(71) In Berlin wurde bisher das Prinzip beibehalten, daß Flüchtlinge und Asylbewerber – falls sie medizinische Hilfe benötigen – diese primär durch einen der niedergelassenen Ärzte erhalten. Pläne eines Wohlfahrtsverbandes, selber mehrere Ärzte zur ausschließlichen Versorgung dieser Personengruppe anzustellen, scheiterten in den 80er Jahren am Widerstand anderer Ärzte und politischen Gruppierungen.
(72) Formale Voraussetzung dafür ist die Bereitstellung eines Krankenscheines. Zum einen weist dieser den „Inhaber” als berechtigt aus, Leistungen, in welchem Maße auch immer, zu erhalten – zum anderen ist er für den Arzt Voraussetzung, daß die erbrachten Leistungen auch vergütet werden.
2.2.1.1 Krankenscheine
(73) Für die Bereitstellung und Ausgestaltung sozialer Hilfen, auch der medizinischen, sind in Berlin unterschiedliche Stellen zuständig. Dies ist u.a. abhängig davon, ob die Asylsuchenden nach Stellung ihres Asylantrages eine Aufenthaltszuweisung für Berlin erhalten haben oder einem anderen Bundesland zugeteilt wurden.
2.2.1.1.1 Zuständigkeiten der Ausstellung von Krankenscheinen
(74) Zuständig für die Ausstellung eines Krankenscheines für Asylbewerber in Wohnheimen war bis zum 31. Dezember 1997 das Berliner Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben .
(75) Durch das Landesgesetz über die Neuorganisation der Gesundheits-, Sozial- und Arbeitsschutzverwaltung vom 12. November 1997 sind ab 1. Januar 1998 die Aufgaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin (LaSoz) auf das neu eingerichtete Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo)übertragen worden. (22)
(76) Ab Zeitpunkt der Errichtung ist das LAGeSo zuständig für die bisherigen Aufgaben des Landesamtes für Zentrale Soziale Aufgaben Berlin – Landesversorgungsamt, einschließlich der ihm nachgeordneten Einrichtungen. (23)
(77) Nach dem Gesetzestext bedeutet dies auch die Zuständigkeit für Leistungen – also auch der Ausgabe von Krankenscheinen – für Asylbewerber, die in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Außerdem ist LAGeSo während einer Übergangszeit zuständig für Leistungen – auch der Krankenscheinausgabe – an ehemalige Asylbewerber nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylantrages und für Personen in der Abschiebungshaft.
(78) Für Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber in Privatwohnungen sind die jeweiligen bezirklichen Sozialämter im Wohnbezirk in der Pflicht.
(79) Für zur Ausreise verpflichtete ehemalige Asylbewerber, Geduldete, Kontingentflüchtlinge, Personen mit Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbefugnis sind ebenfalls die Bezirksämter zuständig.
Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den Bezirksämtern sind die „Ausführungsvorschriften über die örtliche Zuständigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe“ (24)
maßgebend.
2.2.1.1.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(80) Die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind sowohl in der ersten Phase ihres Aufenthaltes in der Berliner Clearingstelle als auch in der folgenden Zeit ihrer Unterbringung in Nachfolgeeinrichtungen der Jugendhilfe auf Sozialleistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) angewiesen.
(81) Benötigen sie ärztliche Hilfe, erhalten sie ohne bürokratische Hürden einen Krankenschein von der Leitung der Clearingstelle.
Halten sie sich später in den Nachfolgeeinrichtungen der Jugendhilfe auf, wird dieser ihnen auch dort direkt ausgehändigt.
2.2.1.1.3 Voraussetzungen für die Ausstellung von Krankenscheinen
(82) Wird für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen der Erhalt von Krankenscheinen – jetzt der Chipkarte – höchstens durch zuvor geschuldete Mitgliedsbeiträge verzögert, stellt die Vergabe der Krankenscheine für Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlinge durch die jeweils zuständige Sozialbehörde noch immer ein kompliziertes Verwaltungshandeln dar.
(83) In Berlin wird kranken Asylbewerbern in Erstaufnahmeeinrichtungen vor ihrem ersten Arztbesuch ein sog. Anforderungsschein für einen Krankenschein von Quartalsdauer ausgehändigt. Diesen erhalten sie von Mitarbeitern der Unterkunft mit der Aufforderung, den Schein bei ihrem Arztbesuch unterschreiben zu lassen verbunden mit der Bitte, dieses Schriftstück dann an die ZLA zu schicken. Von dort werde der Arzt den benötigten Krankenschein erhalten. Gleiches gilt für Personen, die sich in Gemeinschaftsunterkünften aufhalten.
(84) Die Bedingungen, einen Krankenschein zu erhalten, sind in den einzelnen bezirklichen Sozialämtern unterschiedlich. Eine Umfrage der Flüchtlingsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt aus dem Jahre 1995 bei allen Berliner Sozialämtern ergab, daß einige das zuvor beschriebene Verfahren der ZLA praktizieren, andere verlangen von den Betreffenden einen formlosen Antrag auf Aushändigung eines Krankenscheines, wiederum andere benötigen den Nachweis, daß bereits ein Arztbesuch erfolgte (ohne Krankenschein) oder verlangen, daß Name und Adresse des behandelnden Arztes der Behörde mitgeteilt werden.
(85) Begründet werden diese unterschiedlichen Verfahren vor allem damit, daß sich die Behörden vor Aushändigung eines Krankenscheines jeweils vergewissern wollen, ob der Kranke auch definitiv einen namentlich genannten Arzt aufsucht oder aufgesucht und nicht etwa diesen Krankenschein einem anderen Menschen überlassen hat.
(86) Neben der Prüfung des Leistungsanspruchs der jeweiligen Person will natürlich die Behörde zurückverfolgen können, welche Leistungen in welcher Höhe von welchem Arzt erbracht wurden.
(87) Denn, falls es sich später doch noch herausstellen sollte, daß kein Leistungsanspruch vorlag, oder ein anderer Kostenträger ermittelt wurde (Privatperson, anderes Sozialamt), werden die entstandenen Kosten natürlich diesen in Rechnung gestellt.
2.2.1.1.4 Mögliche Konsequenzen für Patient und Arzt
(88) Das komplizierte Verfahren stellt eine Verlagerung von Verwaltungshandlungen auf die Ebene der behandelnden Ärzte dar. Dies entbehrt jeder vertraglichen Fixierung.
(89) Durch die verfahrensbedingte zeitliche Verzögerung der Zusendung des Krankenscheines kann es bei Ärzten zu finanziellen Verlusten durch die dann nicht fristgerechte, quartalsmäßige Krankenscheinabgabe bei der Kassenärztlichen- bzw. Zahnkassenärztlichen Vereinigung kommen.
(90) Nicht wenige niedergelassenen Ärzte verweigern sich deshalb diesem procedere gänzlich und lehnen die Behandlung von vornherein ab, andere erwarten von den fast immer mittellosen Patienten, daß sie bis zum Eingang des Krankenscheines ein finanzielles Pfand von bis zu 50,- DM hinterlegen.
(91) Es kann nicht deutlich genug festgestellt werden, daß die Weigerung, diese Personen zu behandeln, unethisch ist und im Zweifelsfall den Straftatsbestand der unterlassenen Hilfeleistung erfüllt. Der gleiche Effekt tritt natürlich auch dann ein, wenn bei fehlendem Krankenschein das geforderte finanzielle Pfand nicht beigebracht werden kann.
(92) Bei weitem wichtiger ist aber die Tatsache, daß ein derartiges behördliches Verfahren geeignet ist, eben das zu verhindern, was eigentlich ermöglicht werden sollte – im Bedarfsfall schnelle ärztliche Hilfe zu gewährleisten.
(93) Ist es für Deutsche schon mühsam, einen Arzt des Vertrauens zu finden, wird dies einem Ausländer noch viel schwerer fallen. Liegen ihm doch wenige oder keine Informationen und Erfahrungen über unser Gesundheitssystem vor. Er kann sich nicht auf Empfehlungen anderer berufen und weiß auch nicht, ob das medizinische Personal der Praxis seine Landessprache spricht oder ob überhaupt eine Kommunikation in einer anderen Sprache möglich ist.
(94) Da auch entsprechende Hinweise und Hilfen durch das jeweilige Heimpersonal kaum zu erwarten sind, wenden sich kranke Heimbewohner bevorzugt an die Ambulanzen größerer Kliniken ihres Umfeldes oder nehmen sogar den ärztlichen Notdienst in Anspruch. Dadurch entfällt die gesamte Krankenscheinprozedur, das betreuende Heimpersonal braucht sich nicht um Anmeldung und Terminabsprachen in den Arztpraxen zu kümmern und vor allem besteht keine Gefahr, abgewiesen zu werden.
(95) Der teure diagnostische Apparat des Krankenhauses wird in Gang gesetzt, das Resultat steht jedoch im krassen Gegensatz zu den therapeutischen Möglichkeiten in Ambulanz oder Notdienst. Erfolgt nicht „sicherheitshalber” die stationäre Aufnahme, werden vielleicht Medikamente ausgehändigt, um die Zeit zum dennoch später notwendigen Arztbesuch in einer Praxis zu überbrücken. Ratschläge fruchten nicht, weil keine Sprachmittler hinzugezogen werden können. Nicht selten beginnt Tage später die gesamte Prozedur wieder von Neuem. Sie hat immense Kosten verursacht, im Grunde fast nichts bewirkt und war vielleicht sogar Ursache einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes durch Therapieverschleppung.
2.2.1.1.5 Ausstellung eines Zweitkrankenscheines
(96) Meint ein Kranker, der zuvor im Gültigkeitszeitraum seines Krankenscheines schon einen anderen niedergelassenen Arzt der gleichen Fachgruppe aufgesucht hatte, er müsse noch einen zweiten Arzt konsultieren – z. B. wegen fehlender Kommunikationsmöglichkeit, mangelndem Vertrauen oder der Weigerung, für Behörden notwendige Atteste auszustellen – wird dies oft zu einem Parforceritt durch die Behörden.
(97) Bringt er dieses Anliegen der Sozialbehörde persönlich vor, wird ihm kein Gehör geschenkt.
Macht der zweitbehandelnde Arzt sich zum Fürsprecher des Patienten, setzt dieser sich möglicherweise dem Vorwurf eigener Vorteilnahme aus.
So folgt als erstes immer der Hinweis von Behördenmitarbeitern, die Aushändigung eines Zweitkrankenscheines sei überhaupt nicht statthaft. Nach weiterer Intervention und Richtigstellung dieser Behauptung folgt die Vermutung, „Asylbewerber treiben mit Krankenscheinen einen schwunghaften Handel“. Auch fehlt nicht der Hinweis, daß Asylsuchende in ihrem Herkunftsland ja schließlich überhaupt nicht zum Arzt gehen könnten und hier wollten sie sich „sogar noch goldene Zähne einbauen lassen”.
(98) Die geschilderte Eskalation dieser „Argumentationskette” von sachlich unzutreffenden Hinweisen auf behördliche Bestimmungen bis zu Bemerkungen, die als rassistisch zu werten sind, hat der Autor im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit als niedergelassener Arzt unzähligemale erlebt.
Letztendlich wurde dann doch immer der benötigte Krankenschein ausgestellt, allerdings waren langer Atem und Überzeugungsgeschick bis hin zu Drohungen notwendig.
2.2.1.1.6 Ausstellung eines Krankenscheines durch eine Behörde außerhalb Berlins
(99) Hält sich ein Asylbewerber/Flüchtling erlaubterweise vorübergehend im Gebiet einer anderen Ausländerbehörde auf, kann im Bedarfsfall von der entsprechenden Sozialbehörde dieses Gebietes ein Krankenschein ausgestellt werden.
(100) Es gibt eine Vielzahl guter Gründe und verständlicher Zwänge, die räumliche Aufenthaltsbeschränkung auch einmal zu umgehen. Sie stehen in einem umgekehrten Verhältnis zur Zahl der dafür erteilten Genehmigungen.
Nur mit behördlicher Billigung ist ein Wiedersehen mit Familienangehörigen nach Jahren der Trennung möglich oder die Einleitung notwendiger Schritte bei einer geplanten Heirat. Selbst eine Vorstellung im Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin hängt von derartigen Genehmigungen ab.
(101) Erkrankt die betreffende Person gerade in der Zeit ihrer Abwesenheit vom zugewiesenen Aufenthaltsort, hat sie nur Anspruch auf unaufschiebbar gebotene medizinische Hilfe.
(102) Hält sie sich dagegen unerlaubt in einem anderen Gebiet auf und hat damit die Präsenzpflicht umgangen, ist selbst dieser Anspruch nur schwer realisierbar. Weder für Asylsuchende, noch für Ärzte, ist dieses restriktive Verfahren tolerierbar. Alle medizinischen und humanitären Argumente sprechen dagegen.
(103) Da aber auch hier die Erfahrung bestätigt, daß auf dem Gebiet des Verwaltungshandelns Ermessensspielräume vorhanden sind, sollte man nie darauf verzichten, durch direkte Intervention beim Sozialamt des primären Aufenthaltsortes des Patienten auf die Herausgabe und Zusendung des Krankenscheines zu dringen. Falls das zuständige Sozialamt dies ablehnt, empfiehlt es sich, dem Sozialamt die erbrachten medizinischen Leistungen in Rechnung zu stellen und evtl. sogar den Klageweg zu beschreiten.
2.2.1.2 Daten und Datenmißbrauch auf Krankenscheinen
(104) Asylsuchende und Flüchtlinge in Deutschland sind in vielerlei Hinsicht existentieller Rechte beraubt, die wir für uns selber als selbstverständlich und unveräußerlich erachten. So ist für sie das grundgesetzlich verankerte Recht auf körperliche Unversehrtheit außer Kraft gesetzt. Auch viele Datenschutzbestimmungen gelten für sie nicht.
(105) So erschienen unwidersprochen seit mehreren Jahren auf Berliner Krankenscheinen der Sozialbehörde anzukreuzende Rubriken mit Kürzeln, die den aufenthaltsrechtlichen Status des Leistungsberechtigten outeten.
So stand „Asy“ für: berechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und „AsA“ für: berechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Leistungen analog zum Bundessozialhilfegesetz.
Diese Kürzel sind seit 1. Quartal 1998 zu einem „A“ zusammengefaßt worden und signalisieren Anspruchberechtigung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
(106) Auch Hinweise auf die räumlich beschränkte Gültigkeit des Krankenscheines fehlen nicht, z.B. „Achtung: Gilt nicht für Berlin“ oder: „Nur für medizinische Einrichtungen des Landkreises Bautzen“.
(107) Sogar der Aufenthaltsstatus des Betreffenden ist es wert, auf dem Krankenschein festgehalten zu werden, z.B.: „Duldung“.
(108) Selbst unkommentierte und stark gekürzte Texte des Asylbewerberleistungsgesetzes werden auf den Krankenschein gedruckt, um so dem Arzt die Begrenzung der von ihm zu erbringenden Leistungen klarzumachen.
(109) Wenn der Text zwar, wie auf Berliner Krankenscheinen, wiedergibt, daß nur Leistungen zur Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände gewährt werden oder im Einzelfall Leistungen, die zur Sicherung der Gesundheit unerläßlich sind – jedoch keine Hinweise auf Leistungen bei Schwangeren, bei Familienplanung und Schwangerschaftsabbrüchen, bei Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen enthält, kommt dieses Verfahren einer bewußten Irreführung gleich.
(110) Bis zur Einführung der Krankenkassen-Chipkarten hat auch keine der zahlreichen Krankenkassen irgendwelche Bedingungen oder Aufzählungen von Leistungen auf ihren Krankenscheinen mitgeteilt. So wird der Krankenschein zum Vehikel für Verwaltungsdaten, zum Hinweis auf die soziale und ausländerrechtliche Situation der Leistungsberechtigten und zur Quasi-Drohung gegenüber dem Arzt, mit seiner Fürsorge dem Kranken gegenüber möglichst sparsam, restriktiv und zögerlich umzugehen.
(111) In ähnlichen Fällen hat Pro Asyl die Verknüpfung von sozialhilferechtlichen- mit ausländerrechtlichen Personendaten auf Krankenscheinen als einen Bruch datenschutzrechtlicher Vorgaben beklagt und eine Änderung des Verfahrens erreicht.
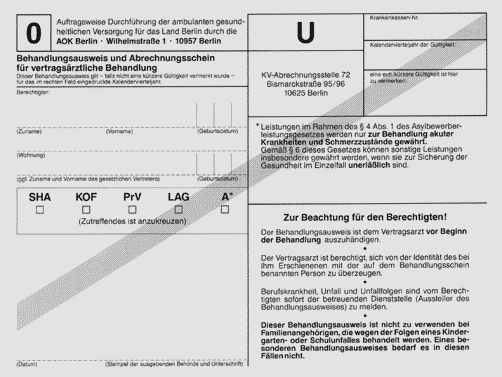
Der auch für Anspruchberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geltende Krankenschein ist mit dem Aufdruck eines unzulässig gekürzten, irreführenden Textteils des Asylbewerberleistungsgesetzes versehen.
(112) Aber auch der Sozialstatus Deutscher wird auf Krankenscheinen festgehalten. Das Kürzel „SHA“ steht für: Sozialhilfeempfänger, „KOF“ für: Kriegsopferfürsorge, „PRV“ für: politisch, rassisch Verfolgte und diejenigen, die nach dem Lastenausgleichgesetz leistungsberechtigt sind, markiert das Kürzel „LAG“.
2.2.1.3 Verordnung von Medikamenten – Regreß
(113) (lg) Im Bereich der medizinischen Versorgung ihrer Patienten sind die Kassenärzte strengen Regeln der Auswahl und Begrenzung unterworfen. Die Überschreitung eines vorgegebenen „Budgets” kann Regreßansprüche der gesetzlichen Krankenkassen gegenüber dem Arzt zur Folge haben.
Darüber hinaus dürfen bestimmte Medikamente gegen „Bagatellerkrankungen” und „Befindlichkeitsstörungen” – außer bei Kindern – nicht verordnet werden.
Zu diesen Medikamenten zählen u.a. Kopf- und Zahnschmerzmittel, Schlafmittel, Hustenmedikamente und Abführmittel.
Gleiches gilt für Schnellverbände zur Verwendung bei Bagatellverletzungen und für Medikamente gegen Parasiten. Auch bei der Verordnung von Psychopharmaka wird – wenn auch nicht nur aus Kostengründen – äußerste Zurückhaltung gefordert.
Auch hier greifen die Krankenkassen zum Mittel des Regresses bis zur Kostenrückerstattung der verschriebenen Medikamente durch den Arzt.
(114) Asylbewerber und Flüchtlinge sind von diesen Regelungen besonders hart betroffen: das gewährte geringe Taschengeld reicht nicht einmal für die Bedürfnisse des Alltags, sodaß im Allgemeinen auf die Beschaffung der genannten Medikamente verzichtet werden muß, unter Inkaufnahme des Fortbestehens oder gar Verschlimmerung der Beschwerden.
(115) Die Möglichkeit einer evtl.Erstattung von diesbezüglichen Ausgaben dürfte in Anbetracht der langen Voranmelde- und Wartezeiten auf den Sozialämtern und der Abhängigkeit von Einzelentscheidungen der Sozialamtsangestellten rein theoretisch sein. Zumeist können auch keine Belege (Apothekenquittungen) beigebracht werden.
(116) Andererseits besteht gerade bei Flüchtlingen, eher als bei einer vergleichbaren deutschen Patientengruppe, ein dringender Bedarf an Medikamenten dieser Art. Sind doch teilweise erhebliche Beschwerden und Krankheitsbilder, die keinesfalls nur als „Befindlichkeitsstörungen” abgetan werden können, geradezu vorprogrammiert: psychische und psychosomatische Störungen durch Fluchtumstände, durch Heimunterbringung auf engem Raum mit Menschen anderer Kultur und Mentalität und durch den sog. Kultur- und Zivilisationsschock.
Hier muß auch an die für viele Flüchtlinge erhebliche Ernährungs- und Klimaumstellung (Verdauungsschwierigkeiten, Erkältungsinfekte) gedacht werden.
(117) Eine Verbesserung der Lage der Flüchtlinge und Asylbewerber ist auch auf diesem Gebiet, nicht nur aus humanen Gründen, dringendst erforderlich.
2.2.1.4 Sprachmittlung
(118) (ev) Deutsch ist Amtssprache. In allen Berliner Amtsstuben werden deshalb Benachrichtungen, Verfügungen und Urteile nur in deutscher Sprache verfaßt und den oft deutschunkundigen Ausländern zugestellt, egal, welche Konsequenzen dies möglicherweise für sie hat.
(119) Zur Wahrung elementarer Interessen des Staates – so im Asylverfahren während der Anhörung der Betreffenden oder zur Klärung ordnungs- oder strafrechtlicher Umstände, ist die aktive Mitwirkung der asylsuchenden Ausländer oder Flüchtlinge vonnöten. Nur dann werden zur Gewährleistung der Kommunikation Dolmetscher ins Verfahren eingebracht.
In allen anderen Lebensbereichen und Kommunikationsebenen bleibt die Verständigung auf die individiuellen Sprachkenntnisse der jeweiligen Gegenüber beschränkt – so auch im Bereich der Medizin.
(120) Im täglichen Praxisbetrieb bedeutet dies im Extremfall, durch völliges Fehlen der Verständigung keine Anamnese erheben zu können und auch sonst bar jeglicher Informationen zu sein. Folglich sieht man sich in Versuchung, durch ausufernde, teure Diagnostik und Polypragmasie diese Defizite auszugleichen. Therapieerfolge gehören dann allerdings zu den Seltenheiten.
(121) Unabsehbar wären die Konsequenzen für Ärzte in Praxis oder Krankenhaus und deren Versicherungen, hätten die Betroffenen die Möglichkeit, einen finanziellen Ausgleich bis hin zu Rentenansprüchen für erlittene Schäden in Folge fehlender Information und Aufklärung in ihrer Muttersprache, z.B. vor diagnostischen Eingriffen oder Operationen, zivilrechtlich einzuklagen – so, wie es von deutschen Patienten praktiziert wird. In einer Arzthaftungsfrage stellte ein Berliner Gutachter wohl mit Recht fest, es sei „nur in wenigen deutschen Kliniken möglich, eine Aufklärung über das Vorgehen, die speziellen Risiken und möglichen Komplikationen einer Periduralanästhesie in russischer Sprache, der die Klägerin offenbar mächtig ist, durchzuführen”.
(122) Ebenso sind die finanziellen Schäden der Kostenträger bei stationärer Behandlung bisher nicht kalkuliert worden, die durch die Verlängerung der Verweildauer der Patienten im Krankenhaus entstehen, wenn nicht bei Bedarf auf Dolmetscher oder Sprachmittler zurückgegriffen werden kann.
Beispielgebend hat die Universitätsklinik Hamburg/Eppendorf auf derartige Erkenntnis reagiert und einen gut funktionierenden Dolmetscherdienst – nicht nur für ihr eigenes Haus – aufgebaut.
(123) Solange nicht zentrale, für alle im Medizinbereich Tätigen abrufbare polyglotte Sprachmittlersysteme zur Verfügung stehen und vor allem deren Finanzierung gewährleistet ist, bleibt es den Einzelnen überlassen, nach ihren begrenzten Möglichkeiten ein System im Kleinen aufzubauen und sich einer Anzahl Menschen zu vergewissern, die ihre Sprachkenntnisse kostenlos zur Verfügung stellen.
Damit werden Staat und die Kostenträger medizinischer Leistungen entpflichtet und ihre Verantwortung auf andere Ebenen relegiert. Die Erfahrung zeigt, daß dies nicht praktikabel ist und dem Sinn des Subsidiaritätsprinzips widerspricht.
(124) Um trotzdem und vorerst eine annähernd praktikable Lösung zu finden, kann es von Nutzen sein, sich mit Ärzten kurzzuschalten, die selber eine der benötigten Fremdsprachen sprechen. Im Kompendium Medizin in Berlin (25) sind entsprechende Hinweise enthalten. Flüchtlingsberatungsstellen können auch Sprachmittler benennen und in den jeweiligen Unterkünften der Patienten sind auch Bewohner bereit, ihre Sprachkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Eine Anfrage bei der Heimleitung kann dies klären.
(125) Vorrangig ist die Klärung der Frage, ob und wie die Kosten für Dolmetscherdienste im Rahmen der klinischen Versorgung über den Pflegesatz abrechenbar sind und wie Kostenträger und Leistungerbringer sich in entsprechende Finanzierungskonzepte für Dolmetscherdienste einbinden lassen.
(126) Wird vom Klinikspersonal weiterhin auf Mitarbeiter anderer Sprache zurückgegriffen, die meist bar jeglicher medizinischer Vorbildung sind, statt in Sprach- und Dolmetscherbüros Profis anzufordern, wird eine befriedigende Lösung weiter auf sich warten lassen.
2.2.2 Krankenhausambulanzen – Rettungsstellen – Notdienste
(127) (up) Die medizinische Versorgung ausländischer Patienten erstreckt sich in der Regel nicht nur auf Erkennen, Werten und Behandeln körperlicher Beschwerden, häufig liegen auch psychosoziale Gründe als schwerwiegende Begleiterscheinungen vor, die die Einschätzung vorliegender Symptome erschweren. Hinzu kommen Schwierigkeiten der sprachlichen Verständigung.
Es bedarf also sehr viel Gespür beim Umgang mit dieser Gruppe von Patienten. Häufig kann man, bedingt durch die Hektik in der Rettungsstelle, ihnen nicht annähernd gerecht werden, vor allem wenn es gilt, viele Patienten erstversorgen zu müssen.
(128) Hilfreich können in derartigen Situationen Familienangehörige oder Freunde des Patienten sein, wenn sie bei Bedarf auch als Sprachmittler fungieren. Dabei ist es eine besondere Herausforderung für das Personal, die Lage der Flüchtlinge mit ihrer ungesicherten Zukunft zu begreifen und sich entsprechend einfühl- und behutsam zu verhalten.
(129) Es ist wichtig, daß sich die Patienten ernst genommen fühlen und nicht, wie sie leider häufig erfahren müssen, als lästig und Bittsteller wahrgenommen werden.
2.3 Stationäre medizinische Versorgung von Ausländern mit gesetzlichem Anspruch
2.3.1 Einweisungen
(130) Kommt ein ausländischer Patient mit einer Einweisung ins Krankenhaus, hat der Ablauf der Versorgung selbstverständlich unabhängig von seiner Nationalität und seines Aufenthaltsstatuts zu erfolgen.
Die Einweisung erfolgt durch einen niedergelassenen Arzt, weil das Krankheitsbild eine ambulante Behandlung nicht zuläßt.
2.3.1.1 Amtsärztliche Überprüfung von Einweisungen
(131) Bei Deutschen ist eine amtsärztliche Überprüfung von Krankenhauseinweisungen nicht gegeben, es sei denn, der stationär zu erbringende Leistungsumfang ist nicht durch den Leistungsumfang der jeweiligen Krankenkasse gedeckt. Von seiten des Krankenhauses besteht Behandlungspflicht.
(132) Für Deutsche wie Ausländer, die nach BSHG Krankenhilfe erhalten, orientiert sich der Leistungsumfang an dem der AOK. (26)
(133) Das Asylbewerberleistungsgesetz differenziert – sachlich unzulässig – nach „behandlungswürdigen“ Krankheiten und solchen, für die eine Kostenübernahme nicht gewährt wird.
(134) Nach dem Gesetzestext wird der Leistungsumfang auf die Behandlung und Gewährung sonstiger Hilfen zur Behandlung von akuten Erkrankungen und von Schmerzzuständen eingeschränkt. (27) Bei sonstigen (chronischen) Erkrankungen wird nur dann geleistet, wenn dies zur Sicherung der Gesundheit unerläßlich ist. (28)
(135) Vermerkt der einweisende Arzt auf seiner Krankenhauseinweisung nicht ausdrücklich „Unabweisbarkeit“ oder „Lebensgefahr“ oder eine ähnliche Begründung, aus der ein akut-notwendiger oder unaufschiebbarer Grund zur Klinikaufnahme hervorgeht, werden Sachbearbeiter der jeweiligen Sozialbehörde entweder in „eigener Vollkommenheit“ die Kostenübernahme ablehnen, oder – wie vorgeschrieben – die Krankenhauseinweisung zur Stellungnahme an einen Amtsarzt des Bezirkes weiterleiten, in dem der Kranke wohnt.
In nicht zu kalkulierenden Zeiträumen, frühestens jedoch in 14 Tagen, erfolgt dann die Entscheidung per Aktenlage. Nur selten wird der Patient noch vor der Stellungnahme amtsärztlich untersucht.
(136) Naturgemäß kann über die Zahl verweigerter Kostenübernahmen hier nichts konkretes gesagt werden. Umfragen bei verschiedenen Sozialämtern und Flüchtlingsberatungsstellen lassen die Vermutung zu, daß jede 3. Krankenhausbehandlung abgelehnt wird.
(137) Bei der Überprüfung einer Einweisung durch den Amtsarzt obliegt es diesem allerdings auch, sich entsprechend der ärztlichen Standesordnung und der Kollegialität zu verhalten und sich vorallem im Blick auf die Folgen seiner evtl. negativen Entscheidung doch besser auf die Seite des Patienten zu schlagen und z.B. einen schwer einstellbaren Diabetes auch schon dann stationär behandeln zu lassen, bevor er komatös entgleist.
(138) Begibt sich der Kranke ohne Krankenhauseinweisung direkt ins Krankenhaus, wird vom diensthabenden Arzt erwartet, daß bei Aufnahme des Kranken diese wegen Unaufschiebbarkeit oder zur Sicherung der Gesundheit unerläßlich notwendig war.
2.3.2 Stationäre Aufnahme
(139) Die stationäre Aufnahme sollte also primär nach medizinischen Kriterien erfolgen.
(140) Dabei darf allerdings nicht unbeachtet bleiben, daß die Patienten schwierigsten psychosozialen Situationen ausgesetzt sind die häufig einer Besserung der Beschwerden oder einer Heilung entgegenstehen – ja selber Krankheitsursachen darstellen, bis hin zum Alkoholismus.
(141) So müssen sie in übervollen Unterkünften ohne Rückzugsmöglichkeiten leben. Ambulant verordnete therapeutische Maßnahmen können deshalb nicht korrekt durchgeführt werden. Auch Krankenpflege ist nicht gewährleistet, wenn Eltern mit zwei Kindern ein höchstens 20m2 großen Raum zugestanden wird. Faktoren, die die Notwendigkeit einer stationären Aufnahme noch verstärken können.
2.3.2.1 Notfall
(142) Da ausländische Patienten, vor allem dann, wenn sie erst kurze Zeit in Deutschland leben, noch keine Hilfe durch niedergelassene Ärzte in Anspruch genommen haben, ist bei auftretenden Beschwerden oder Unfällen häufig die Rettungsstelle eines Krankenhauses der erste Anlaufort.
(143) Der Mangel an Sozialarbeitern in den Flüchtlingsunterkünften begünstigt diese Tenenz. Ihnen verbleibt keine Zeit, um z.B. Termine in Arztpraxen zu organisieren oder sogar die Patienten dorthin zu begleiten.
(144) Die schon geschilderten Schwierigkeiten bei der Bereitstellung eines Krankenscheines durch die Behörden tragen zusätzlich zur hohen Frequentierung von Krankenhausambulanzen, Rettungsstellen und Notdiensten bei.
(145) Selbstverständlich ist eine Erstuntersuchung und notwendigenfalls auch eine stationäre Behandlung durchzuführen oder aber die Weiterleitung an einen niedergelassenen Arzt.
2.3.2.2 Schwangerschaft – Entbindung – Schwangerschaftsabbruch
(146) (ev) Bei Schwangeren mit einem Aufenthaltsstatus ist die Kostenübernahme für die ambulante Betreuung der Schwangerschaft und für die Entbindung unstrittig. Jedoch könnte auch hier, wie in allen sonstigen Fällen, die stationär aufgenommen werden, bei der Ermittlung des jeweiligen Kostenträgers verwaltungsbedingte Schwierigkeiten auftreten.
(147) Das Gleiche gilt für Frauen, deren Schwangerschaft aus den unterschiedlichen Gründen abgebrochen werden soll.
2.4 Medizinische Versorgung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht versus „Illegale”
2.4.1 Definition des Begriffs „Illegaler Ausländer”
(148) Es ist eine Binsenweisheit: Menschen können nicht illegal – nicht „ungesetzlich” – sein. Sie sind auch mitnichten „vogelfrei”. Sie leben jedoch ohne Aufenthaltsrecht unter uns, also ohne staatliche Legitimation. Auf die vielfältigen Gründe wird hier nicht eingegangen.
Da sie als Folge des fehlenden Aufenthaltsrechts auch andere wesentliche Rechte nicht in Anspruch nehmen können, sind sie im Zustand andauernder Ängste und Hilflosigkeit. Der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft sind fast keine Grenzen gesetzt.
(149) Um der weiteren Stigmatisierung und Kriminalisierung dieser Personen zu begegnen haben sich die Autoren geeinigt, den Begriff „Illegale” in ihrem Sprachgebrauch durch „Ausländer ohne Aufenthaltsrecht” zu ersetzen.
(150) Die folgenden Ausführungen beziehen sich also auf diejenigen Ausländer ohne Aufenthaltsrecht, die entweder keine- oder abgelaufene Papiere haben.
Dazu zählen u.a.: (29)
- Inhaber einer Grenzübertrittsbescheinigung oder einer Paßeinzugsbescheinigung (vergl. 2.1.1.4.),
- aus Angst vor Abschiebung untergetauchte Asylbewerber
- Studenten mit abgelaufener Aufenthaltsbewilligung,
- rechtswidrig Eingereiste (Arbeitsmigranten, Sexarbeiterinnen, Opfer von Frauenhandel),
- eingereiste Ausländer mit überzogenem Besuchsvisum,
- hier lebende Angehörige ohne gültigen Aufenthalt von Ausländern, die sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten,
- Ausländer mit ungeklärter Staatsangehörigkeit.
2.4.2 Ethische Erwägungen zur ärztlichen Versorgung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht
(151) (ks) Ärztliches Handeln sollte in erster Linie dem Wohlergehen der Kranken dienen (salus aegroti suprema lex). Dieser an sich nicht zu widersprechenden ethischen Forderung werden insbesondere in jüngerer Zeit immer mehr Hindernisse in den Weg gelegt, die dazu führen, dem Kranken nicht mit der notwendigen Fürsorge zu begegnen, die er benötigt. Natürlich sind von diesen Barrieren nicht diejenigen Patienten betroffen, die Mitglied einer privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung sind, sondern Menschen ohne Krankenversicherung, und vielleicht noch gravierender: ohne deutschen Paß.
Natürlich sind in Deutschland und vielleicht speziell in Berlin insbesondere seit der Wiedervereinigung die sozialen Probleme stark angewachsen. Millionen von Menschen sind ohne regelmäßige Arbeit, viele haben Angst vor der Zukunft, sehen kein „Licht im Tunnel” und fragen nach Gründen ihrer sozialen Not. Es wird ihnen suggeriert, daß Ausländer, und hier insbesondere Flüchtlinge, das soziale Netz mißbrauchen und somit zumindest partiell die eigene soziale Not mitverursachen. Die Konsequenz ist eine wachsende Ablehnung von allem Fremden in unserer Gesellschaft, Vorurteile werden zum Bestandteil des eigenen Denkens und Handelns und können nun auch ausländischen Kranken begegnen, umsomehr wenn diese keinen „Status” aufweisen, vielleicht Asylsuchende sind, sich illegal in Deutschland aufhalten oder abgeschoben werden sollen. Die erheblichen finanziellen Zwänge, denen das Berliner Gesundheitssystem ausgesetzt ist, stellen zusätzlich Motive dar, weshalb der erwähnten Patientengruppe zu häufig eine Behandlung vorenthalten wird.
Seit Jahren gelten vier Postulate in der Medizinethik, die das Verhalten eines Arzt-/Patientenverhältnisses charakterisieren sollen: Autonomie, Gerechtigkeit, Vermeidung von Schaden und Wohltätigkeit. Die „Wohltätigkeit” sollte keinesfalls nur als „nihil nocere” verstanden sein, sondern vielmehr als Nächstenliebe im jüdisch-christlichen Verständnis. Den Kranken als Bruder oder Schwester zu sehen und auch so zu behandeln, darf vom Arzt erwartet werden. Nur diese Art der Zuwendung läßt keinen Raum für abfällige Urteile über Menschen und ermöglicht allein die Behandlung eines jeden Kranken, unabhängig davon, ob er reich oder arm, jung oder alt, gepflegt oder vor Schmutz starrend, schwarz oder weiß, legal oder illegal, deutsch oder nicht-deutsch, mit oder ohne Wohnsitz ist. Ein Arzt darf seine Zuwendung eben nicht von diesen Kriterien abhängig machen, sondern muß helfen, heilen und Fürsorge ausüben, selbst wenn er den hilfesuchenden Kranken verabscheut.
Salus aegroti suprema lex entspricht einer „Ethik der Fürsorge” und eine Ethik der Fürsorge macht nicht Halt vor Patienten ohne Krankenschein. Die medizinische Behandlung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht sollte eine wichtige Verpflichtung von Ärzten darstellen, sie dürfen sich nicht von dieser Verpflichtung ablenken lassen und schon gar nicht aus den jetzt so oft zitierten finanziellen Zwängen.
2.4.3 Ambulante medizinische Versorgung
2.4.3.1 Niedergelassene Ärzte
(152) (ev) Die kostenlose ambulante Behandlung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht wird immer dann zum Problem, wenn viele Patienten die noch immer recht wenigen Praxen aufsuchen, welche bereit sind, auch ohne Kostenübernahme bzw. Krankenschein zu behandeln.
(153) Einerseits ist in den verschiedenen ärztlichen Fachgruppen die Bereitschaft dazu unterschiedlich stark ausgeprägt, andererseits sind die Adressen kooperativer, auch fremdsprachlich gut gerüsteter Praxen in Betreuerkreisen und Beratungsstellen, aber auch in den Senatsverwaltungen, bekannt und werden zunehmend häufig an Hilfesuchende weitergegeben.
Eine Schlüsselrolle nimmt dabei das Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe ein auf das später eingegangen wird.
(154) Schwierigkeiten oder gar Hinderungsgründe, sich an der medizinischen Versorgung dieser Menschen zu beteiligen, sind im Grunde sehr rar.
So könnten Probleme auftreten, wenn nicht nur die eigene ärztliche Leistung erbracht wird, sondern auf ärztliche Fremdleistungen zurückgegriffen werden muß oder noch zusätzlich die Materialkostenkosten getragen werden müssen. Es bedarf dann überzeugender Argumente am Telefon, das Labor oder Röntgeninstitut zu motivieren, in diesem Fall auf Überweisungsschein oder Kostenerstattung zu verzichten.
(155) Sind medikamentöse Therapien notwendig, die sich nicht aus dem eigenen Bestand von Arzneimustern realisieren lassen, obliegt es der Phantasie des Arztes, über Apotheken, Krankenhäuser, Arzneimittelvertreter oder Firmen doch noch die Behandlung zu ermöglichen.
(156) Allerdings sind die Grenzen des Machbaren beim Zahnersatz, bei orthopädischen Hilfsmitteln oder Seh- und Hörhilfen sehr eng gezogen.
Sicher muß neben Geld auch mehr Zeit und Ärger investiert werden – dafür wird aber auch der Erfolg und die Freude darüber auf beiden Seiten realer als üblicherweise sein.
(157) Keinesfalls gelten die immer wieder zu hörenden Bedenken, dies sei alles „nicht statthaft”, man müsse „dies melden” oder man müsse dabei „Vorsicht walten lassen”.
Solche Bedenken entbehren jeglicher gesetzlichen – und erst-recht ethischen Grundlage.
2.4.3.1.1 Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe – Netzwerk
(158) (mf) Das Büro wurde 1996 von antirassistischen Gruppen als Antwort auf die sich verschärfende Asylgesetzgebung gegründet, die Asylbewerbern nur noch stark reduzierte medizinische Hilfe zugesteht und Ausländer ohne Aufenthaltsrecht quasi völlig von der Gesundheitsversorgung ausschließt.
(159) Das Büro vermittelt unbürokratisch, anonym und kostenlos Patienten, die keine andere Möglichkeit der Gesundheitsversorgung haben, an Zahn-/Ärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten, etc. Für schwangere Frauen kann eine Vorsorge, eine Entbindung in einer Klinik und eine Nachsorge organisiert werden. Schwangerschaftsabbrüche sind ebenfalls möglich.
(160) Seit Bestehen der Initiative sind mehr als 700 Vermittlungen von hilfesuchenden Kranken an nunmehr fast 70 Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten erfolgt.
(161) Für Notfälle, größere Operationen oder kompliziertere, kostspieligere bzw. langwierigere Behandlungen wurde bisher jedoch keine Lösung gefunden. Nur in Einzelfällen glückt eine entsprechende Versorgung.
(162) Benötigt werden noch dringend ÄrztInnen etc., die bereit sind, Flüchtlinge ohne Krankenschein zu behandeln. Da das Büro bewußt keine offizielle Förderung erhält, ist es auf steuerabzugsfähige Spenden zur Erstattung von Kosten für Medikamente und medizinischem Material angewiesen.
(163) Neben der praktischen Unterstützungsarbeit ist politische Öffentlichkeitsarbeit der andere Schwerpunkt des Büros. Wie viele andere antirassistische Gruppen beteiligt es sich z.Zt. an der Kampagne „Kein Mensch ist illegal”.
2.4.3.2 Arztmobil der Caritas
(164) (pvb) Das Arztmobil ist ein niedrigschwelliges medizinisches Angebot für Wohnungslose, für Menschen, die aus persönlichen Gründen keine herkömmliche Arztpraxis aufsuchen, auch für Ausländer mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus.
(165) Auf Wunsch werden die Patienten anonym betreut. Die Mitarbeiter des Projektes unterliegen in jeder Hinsicht der Schweigepflicht.
Statistische Erhebungen sind ebenfalls anonym.
(166) Im Arztmobil arbeiten insgesamt sieben Ärzte verschiedener Fachrichtungen, ein Zivildienstleistender eine Krankenschwester und eine Sozialarbeiterin mit Spanischkenntnissen.
(167) Besteht kein Krankenversicherungsschutz – dies ist besonders bei Ausländern ohne Aufenthaltssrecht oder ungeklärtem Aufenthaltsstatus der Fall – stehen auch niedergelassene Ärzte zur Verfügung, die eine Behandlung durchführen.
(168) Im Bedarfsfall werden diese von den Mitarbeitern des Arztmobils vermittelt.
(169) Das Arztmobil ist mit festem Einsatzplan an Suppenküchen und Wohnungslosentagesstätten anzutreffen. Das Büro befindet sich auf dem Gelände des Franziskanerklosters in der Wollankstr. 18 in Pankow. Hier wird nach vorheriger Terminabsprache sozialarbeiterische Hilfe in geschützter Athmosphäre angeboten.
2.4.3.3 Bahnhofsambulanz
(170)
(ev) Seit 1994 wird in Räumen des Geländes vom Hauptbahnhof Berlin die medizinische Versorgung gesetzlich versicherter Obdachloser von einer Ärztin wahrgenommen.
Da im Verlauf der vergangenen Jahre die Zahl der zu versorgenden Obdachlosen weiter rapide zugenommen hat, sah sich die Kassenärztliche Vereinigung endlich gezwungen, eine Sonderzulassung zur Kassenabrechnung auszusprechen.
Obwohl diese leider zunächst nur für ein Jahr gilt, die Räume nicht dauerhaft zur Verfügung stehen und die Arbeit auf Spenden – sogar von Medikamenten – angewiesen ist, tut dies dem Engagement der Ärztin und ihrem Team keinen Abbruch.
(171) Da in der Ambulanz wie in etlichen anderen Arztpraxen der Anspruch ärztlicher Hilfe nicht an persönlichen Daten und Versicherungsverhältnissen festgemacht wird, besteht auch für Ausländer ohne Aufenthaltsrecht die Möglichkeit, dort medizinische Hilfe zu erhalten.
2.4.3.4 Krankenhausambulanzen – Rettungsstellen – Notdienst
(172) (mf) Jedes Krankenhaus (Ausnahme: Privatkliniken, Rehabilitations-Krankenhäuser) verfügt über eine Notfallaufnahme/Rettungsstelle, die rund um die Uhr geöffnet ist und in der medizinische Hilfe geleistet wird.
Wichtig: Es muß eine akute Erkrankung oder eine akute Verschlechterung einer chronischen Erkrankung oder eine (möglicherweise) lebensbedrohliche Situation vorliegen, denn für die „normale“ ambulante Krankenversorgung sind tagsüber die niedergelassenen Ärzte in ihren Praxen zuständig. Abends und nachts, an Wochenenden und Feiertagen kann dann der „Kassenärztlichen Notfalldienst“ in Anspruch genommen werden.
(173) Grundsätzlich muß in jedem Notfall in der Rettungsstelle Erste Hilfe geleistet werden, eine ambulante Weiterbehandlung in der Rettungsstelle ist nicht möglich.
(174) Die Behandlung in den Rettungsstellen ist kostenlos, gewöhnlich wird jedoch nach der Chipkarte der Krankenkasse oder der Krankenversicherung gefragt, damit das Krankenhaus die Kosten der Behandlung von den Versicherungen erstattet bekommt. Allerdings wird von Einzelfällen berichtet, bei denen in Rettungsstellen von Patienten ohne nachgewiesener Krankenversicherung Geld zur Begleichung der entstehenden Kosten gefordert wurde.
(175) Da in Notfällen ärztliche Behandlungspflicht besteht, darf diese nicht davon abhängig gemacht werden, ob eine Chipkarte vorliegt, die Versicherung des Patienten bekannt ist oder kein Versicherungsschutz besteht. Das gilt natürlich auch bei Mittellosigkeit des Kranken.
(176) Manchmal versuchen Mitarbeiter der Rettungsstellen, von Begleitpersonen der Erkrankten (besonders, wenn diese Deutsche sind) Kostenübernahmeverpflichtungen unterschreiben zu lassen, wenn sie Zweifel an einem existierenden Versicherungsschutz des Patienten haben. Das sollte man strikt ablehnen – eine Behandlung darf deswegen nicht verweigert werden.
(177) Zur Dokumentation der Erkrankungen oder Verletzungen und der medizinischen Maßnahmen werden in der Rettungsstelle Protokolle angefertigt, auf denen auch der Name, das Geburtsdatum und die Adresse des Patienten eingetragen werden. Von diesen Angaben ist eine Behandlung aber nicht abhängig, die Behandlungspflicht gilt auch, wenn PatientInnen dazu keine Angaben machen wollen oder können.
Wichtig: Das Zeigen eines Ausweises erleichtert die Arbeit derjenigen, die das Protokoll ausfüllen, aber niemand ist dazu verpflichtet. Natürlich können auch Ausweis (und Chipkarte) verloren gegangen sein.
(178) Liegt eine schwere gesundheitliche Gefahr oder sogar Lebensbedrohung für den Patienten vor, werden die ÄrztInnen der Rettungsstelle die stationäre Aufnahme ins Krankenhaus empfehlen. Auch dann ist der Nachweis einer Krankenversicherung oder die Vorlage eines Ausweises ebenso wenig notwendig wie das Krankenhaus deshalb die Aufnahme verweigern kann.
(179) Obwohl eine ärztliche Behandlung aufgrund einer akuten gesundheitlichen Notlage gewährt werden muß – unabhängig vom Versicherungs- oder Aufenthaltsstatus30 – stellt das Krankenhaus beim Fehlen einer Krankenversicherung am Ende der Behandlung eine Rechnung aus.
Wichtig: Zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus oder zum Erdulden medizinischer Maßnahmen kann keiner gezwungen werden, es darf auch keiner im Krankenhaus festgehalten werden.
Ausnahmen:
- Psychisch Kranke, die akut sich selbst (Suizid) oder andere Menschen (Gewalttätigkeit) gefährden, können psychiatrisch zwangseingewiesen werden;
- nicht volljährige Kinder und Jugendliche dürfen nur mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten das Krankenhaus verlassen.
(180) Polizei in der Rettungsstelle ist keine Seltenheit. Meistens liefern sie nur Personen ab, die sie hilflos aufgefunden haben (z. B. Alkoholisierte).
In seltenen Fällen suchen sie auch Personen, denen sie Straftaten vorwerfen (z. B. nach Demonstrationen, wenn TeilnehmerInnen verletzt ins Krankenhaus gekommen sind).
Wichtig: Die RettungstellenmitarbeiterInnen dürfen nur zu ihrem eigenen Schutz die Polizei rufen (z.B. bei gewalttätigen PatientInnen), aber nicht zur Identitätsfestellung.
Leider sind derartige Fälle in Berlin schon vorgekommen.
Ratschläge:
(181) Liegen Verletzungen oder Erkrankungen aus dem Bereich der Disziplinen Gynäkologie, Kinderheilkunde, Augen, Hals-Nasen-Ohren, Neurologie, Urologie, usw. vor, sollten die Betroffenen oder die sie betreuenden Personen selber beim nächstgelegenen Krankenhaus anrufen, ob dort eine Abteilung und auch ein Bereitschaftsdienst für das entsprechende Fach vorhanden ist, sonst schickt die Rettungsstelle die Kranken gleich weiter (nach evt. Erstversorgung von Wunden) zur nächsten Rettungsstelle und das Warten beginnt dort von neuem.
(182) Der Kranke sollte möglichst nicht allein in die Rettungsstelle gehen, eine Vertrauensperson, mit der man sich beraten kann, ist wichtig, gerade wenn es einem schlecht geht oder man Schmerzen hat.
(183) Auch sollte immer dann jemand zum dolmetschen mitgenommen werden, wenn man nicht sicher in der deutschen Sprache ist. Es gibt keinen Verlaß auf Fremdsprachenkenntnisse von Rettungstellenmitarbeitern.
(184) Schwangere ohne Aufenthaltsrecht können wie Deutsche zu den gebotenen Vorsorgeuntersuchungen die kostenlosen Schwangerschaftsberatungsstellen der geburtshilflich tätigen Kliniken aufsuchen.
2.4.4 Stationäre medizinische Versorgung
2.4.4.1 Stationäre Aufnahme
(185) (up) Die schwierige Lebenssituation von Menschen ohne Aufenthaltsrecht mit der sich über Jahre hinziehenden hinziehenden Lebensunsicherheit führt zu körperlichen und auch psychischen Gebrechen, die die Menschen schließlich auch in Rettungsstellen der Krankenhäuser führen. Natürlich ist es erste Aufgabe der Diensthabenden, sich den gesundheitlichen Problemen auch dieser Patienten anzunehmen.
(186) Müßte aufgrund des Krankheitsbildes die stationäre Aufnahme erfolgen, stehen dieser höchstens finanzielle Erwägungen im Sinne ungeklärter Kostenübernahme entgegen.
Deshalb werden auch Verwaltungsangestellte der Kliniken versuchen, die Patientendaten festzuhalten, auch die (unstatthafte) Einbehaltung der Personenstandspapiere einschließlich der Pässe ist schon vorgekommen.
Nie jedoch haben Verwaltungsangestellte Order, asylrechtliche Fragen durch Hinzuziehung der Polizei zu klären. Das Krankenhaus hat sich nicht zum verlängerten Arm der Ausländerbehörde zu machen. Das Krankenhauspersonal kann sich nicht nach dem Motto aus der Verantwortung stehlen: „Wer nicht zahlen kann, hat keinen Anspruch auf medizinsiche Versorgung.”.
(187) Selbstverständlich werden mit der verweigerten Aufnahme kranker Ausländer ohne Aufenthaltsrecht menschliche Grundrechte und das Standesrecht verletzt.
(188) Die Qualität der medizinischen Versorgung orientiert sich nicht nur an den großen medizinischen Fortschritten, erst-recht und vor allem daran, wie die Schwächsten unserer Gesellschaft von Ärzten, Pflegenden und auch Verwaltungsangestellten im Krankenhaus mit einer am Menschen orientierten Medizin versorgt werden.
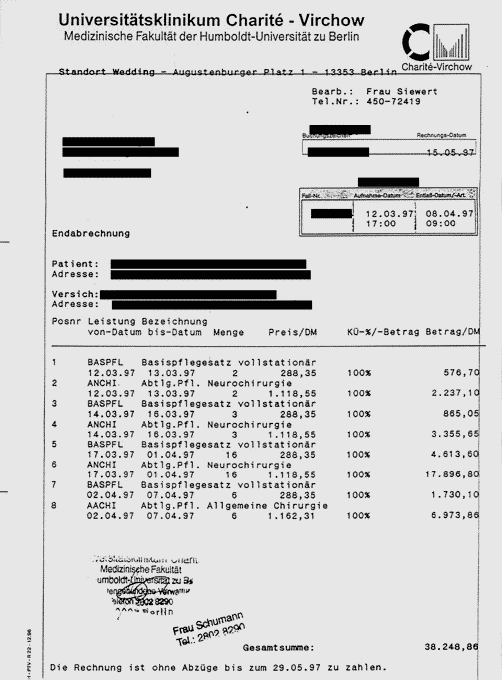
Die erbrachten Leistungen bei einer zu Besuchszwecken eingereisten Ausländerin anläßlich einer stationären Notfallbehandlung wurden in Rechnung gestellt. Die Annahme, eine auf alle Fälle und jedem zu gewährende ärztliche Behandlung aufgrund einer akuten gesundheitlichen Notlage, unabhängig vom Versicherungs- oder Aufenthaltsstatus, sei damit auch für den Betroffenen kostenlos, ist irrig.
2.4.4.1.1 Notfälle
(189) Da sogar der Berliner Senat bestätigte, daß „eine ärztliche Behandlung auf Grund einer akuten gesundheitlichen Notlage jedem, unabhängig vom Versicherungs- oder Aufenthaltsstatus, gewährt werden muß”, sind außer medizinische Gründe keine anderen denkbar, die einer stationären Aufnahme in derartigen Fällen entgegen stehen.
(190) Die stationäre Behandlung sollte dann auch solange andauern, wie es ärztlich vertretbar ist. Nur medizinische – nicht finanzielle – Erwägungen dürfen den Zeitpunkt der Entlassung bestimmen.
(191) Ärztlicher Verantwortung obliegt es, noch während des Klinikaufenthaltes für eine evtl. notwendige ambulante Anschluß behandlung zu sorgen. Welche Möglichkeiten zur Zeit in Berlin zur Verfügung stehen, ist unter 2.4.3 nachzulesen.
2.4.4.1.2 Schwangerschaft – Entbindung – Schwangerschaftsabbruch
(192) (ev) Natürlich muß auch jede geburtshilflich tätige Klinik Schwangere ohne Aufenthaltsrecht bei entsprechender Indikation stationär aufnehmen.
Nach allen Erfahrungen wird jedoch die ungeklärte – vermeintlich fehlende – Kostenübernahme auch hier die Dauer des stationären Aufenthalts bestimmen. So wird eine komplikationslos Entbundene mit ihrem Kind meist schon am folgenden Tag wieder die Klinik verlassen müssen – ohne Kontroll- und Nachuntersuchungen, eventuelle Impfungen oder noch notwendige Therapie.
(193) Da es sich sowohl bei Entbindungen als auch bei entsprechenden gynäkologischen – und geburtshilflichen Indikationen um Notfallsituationen handelt und somit „Unabweisbarkeit” vorliegt, sind auch hier die zuständigen Sozialämter als Kostenerstatter für die stationäre Behandlung in der Pflicht. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß die Patientinnen ihre eigene Identität preisgeben.
(194) Ist – der Not gehorchend – die stationäre Aufnahme unter Verschleierung der eigenen Identität oder unter Angabe falscher Daten unter einer „geliehenen” Identität in den verschiedensten Krankheitssituationen noch möglich, wird dies – falls eine Entbindung bevorsteht – nicht mehr gehen.
Spätestens wenn durch die Klinik die namentliche und staatsbürgerschaftliche Identität des Neugeborenen und dessen Eltern nachgewiesen, festgehalten und dem Standesamt gemeldet werden muß, wird wohl die zuvor gewählte „Identität” bzw. Anonymität aufgegeben werden müssen.
(195) Die Folge einer unglücklichen Kopplung von zweiter Identität mit nachlässigem Verhalten des Kreißsaalpersonals mag folgendes Beispiel illustrieren: Mit geliehener Krankenkassen-Chipkarte einer anderen Person wird eine Schwangere zur Entbindung aufgenommen. Der standesamtliche Eintrag des Kindes erfolgt unter dem geliehenen Nachnamen und der – auch nicht wirklichen – Nationalität.
Folglich muß nun ein gerichtsverwertbarer Nachweis der Mutterschaft geführt werden. Das Kind erhält einen Vormund und wird der Mutter entzogen, die Ausländerbehörde will die Mutter sogar schon vor der Durchführung des Mutterschaftsnachweises abschieben, die Klinik schickt Rechnungen und Gerichte werden die Mutter verklagen. Die Mutter verzweifelt beim Gedanken, ihr Kind gänzlich zu verlieren.
(196) Außerordentlich groß werden die Schwierigkeiten auch dann, wenn ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden soll.
Die ärztliche Begleitung der Frauen bis zum Zeitpunkt dieser Entscheidung ist durch Frauenärzte, die auf Krankenschein bzw. Honorar verzichten, meist noch gewährleistet.
Da aber für einen stationären Schwangerschaftsabbruch weder eine „Unabweisbarkeit” vorliegt noch schwere Krankheiten ursächlich verantwortlich zu machen sind, kommt nur der ambulante Abbruch infrage.
(197) Die wenigsten Ausländerinnen ohne Aufenthaltsrecht sind in der Lage, die dafür benötigten Mittel aufzubringen. Aus finanziellen Gründen, aber auch aus Versicherungserwägungen heraus und Reputationsstreben findet sich meist kein Frauenarzt, der – nach der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung – den Abbruch vornimmt. So erfahren diese ausgegrenzten Frauen in unserer Gesellschaft noch eine weitere Zunahme ihrer Not.
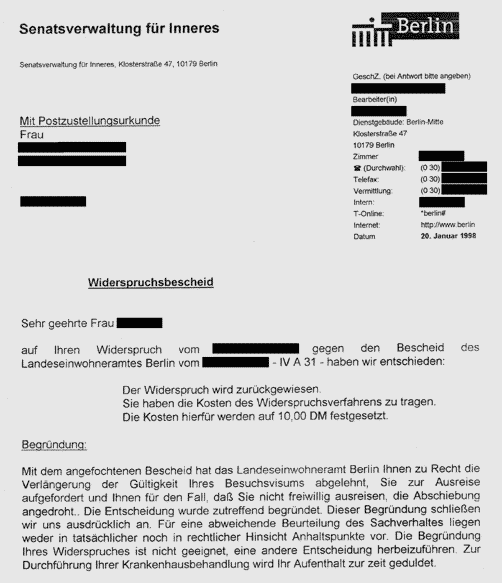
Einem Schwerkranken ohne Aufenthaltsrecht wurde zur Durchführung der Krankenhausbehandlung eine Duldung ausgesprochen, d.h. die Abschiebung wurde vorläufig ausgesetzt.
2.4.5 Krankheit „schafft” Aufenthaltsrecht
(198) Kann die ärztliche Versorgung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht im ambulanten Bereich durch einen Verbund von Ärzten in Praxen und Ambulanzen, die dies kostenlos übernehmen, noch einigen dieser Menschen schwere gesundheitliche Schäden ersparen, wird die Lage für alle Beteiligten unvergleichlich schwieriger, wenn Krankheiten vorliegen, deren weitere Abklärung und Therapie nur noch stationär möglich ist.
(199) Abhängig von der Schwere der Erkrankung, der Dringlichkeit der Therapie und ungeklärter oder fehlender Möglichkeiten, sich im Herkunftsland entsprechend behandeln zu lassen, muß auf alle Fälle versucht werden, die Behandlung hier zu erreichen – will man den Menschen nicht einem unbehandelten Karzinom, einer schweren Herzerkrankung, dem entgleisten Diabetes oder Unfallverletzungen hilfslos überlassen.
(200) Wenn schwerwiegende Gesundheitsgefahren aufgrund schlechter Medizinversorgung im Zielland der Abschiebung zu erwarten sind, kann dies als Abschiebungshindernis für abzuschiebende Kranke gelten. (31)
(201) Um dieses Ziel erreichen zu können, muß zuvor kompetenter Rat bei einer Flüchtlingsberatungsstelle oder einem ausländerrechtlich spezialisierten Rechtsanwalt unter Abwägung des „Für und Wider“ eingezogen werden.
Folgende Schritte sollten dann gegangen werden:
- Der Patient muß den Status des illegalen Aufenthaltes verlassen und sich polizeilich anmelden (bei Bekannten o.ä.).
- Ein ausführliches Attest über die bestehende Krankheit und die Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit der Therapie muß erstellt werden.
- Es soll u.a. unmißverständlich daraus hervorgehen, welche Konsequenzen eine Nichtbehandlung nach sich zieht.
- Eine Flüchtlingsberatungsstelle kann dann einen Antrag auf Duldung aus humanitären Gründen wegen bestehender Krankheit und dringender Therapienotwendigkeit bei der Ausländerbehörde stellen.
- Die Duldung sollte wenigstens solange ausgesprochen werden, bis auch geklärt ist, ob und wo im Herkunftsland die Behandlung schnell und definitiv möglich ist.
- Der Antrag auf Duldung muß vom Betreffenden mit dem Attest, der polizeilichen Anmeldung und 4 Paßbildern zum Landeseinwohneramt (LEA) – Ausländerangelegenheiten in 13353 Berlin, Friedrich-Krause-Ufer 24 gebracht werden.
- Dabei sollte ihn möglichst eine Person begleiten. Dort bekommt er eine Bescheinigung, daß er den Aufenthalt beantragt hat.
- Mit dieser Bescheinigung kann er sich dann an das zuständige Sozialamt wenden und Sozialhilfe und einen Krankenschein im Rahmen des Ermessens beantragen.
- Mit dem Krankenschein sollte er umgehend den Arzt aufsuchen, um die dringend notwendige stationäre Aufnahme zu veranlassen.
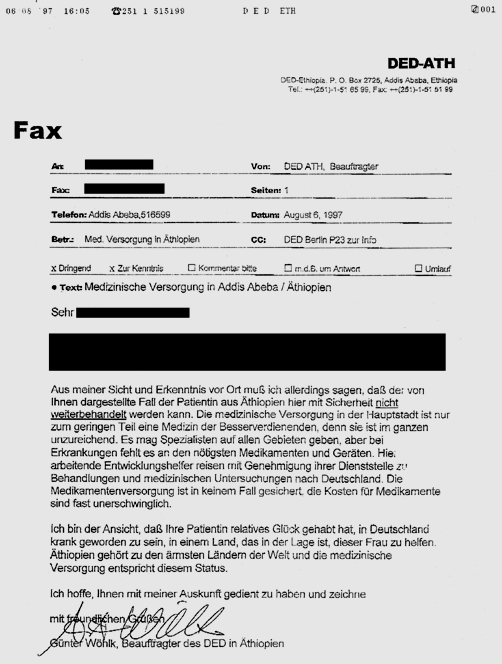
Bestätigung mangelnder medizinischer Versorgung in einem Land, in das eine Patientin ohne Aufenthaltsrecht abgeschoben werden sollte.
2.4.6 Kostenübernahme
2.4.6.1 Sozialamt
(202) Der weit verbreiteten Behauptung, Ausländer ohne Aufenthaltsrecht hätten generell keinen Anspruch auf Leistungen der Krankenbehandlung, muß widersprochen werden.
(203) Bei denjenigen, die mit oder ohne abgelaufene Papiere, ohne gesetzlich krankenversichert zu sein, ihren tatsächlichen Aufenthalt in Berlin haben, kommt bei stationärer Behandlung das Sozialamt des Wohnbezirkes als Leistungsträger in Betracht. (32)
(204) Haben Ausländer ohne Aufenthaltsrecht ihren Wohnsitz nicht, ihren tatsächlichen Aufenthalt aber doch in Berlin, ist immer dann das Sozialamt des Krankenhausbezirkes zuständig, wenn es sich um Eilfälle handelt oder andere Zuständigkeiten innerhalb von 4 Wochen nicht feststellbar sind. (33|34)
2.4.6.2 Defizite der Krankenhäuser durch nicht erfolgte Kostenübernahme
(205) Durch öffentliche Äußerungen leitender Mitarbeiter der Charité in den beiden vergangenen Jahren wurde jedoch der Eindruck vermittelt, die Krankenhäuser würden in diesen Fällen auf den verursachten Kosten „sitzenbleiben” und dadurch Defizite in Millionenhöhe erfahren.
(206) Eine Umfrage der Arbeitsgruppe Medizin des Flüchtlingsrates Berlin bei 26 Berliner Krankenhausverwaltungen im Frühjahr 1997 ergab allerdings, daß die finanziellen Defizite bei stationärer Behandlung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht doch von untergeordneter Bedeutung waren. (35)
Nur zwei Krankenhäuser bestätigten, überhaupt Verluste erlitten zu haben und dies nur in geringer Höhe – wohl ganz im Gegensatz zur Charité.
(207) Auch das Verfahren der Charité, Ausländer ohne Aufenthaltsstatus mit zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Kostendeckung durch die Sozialämter auf eigene Kosten und so schnell wie möglich nach Anbehandlung ins Herkunftsland zu transportieren, (36) war Anlaß zur Umfrage.
(208) Um die Minimierung möglicher Defizite durch Rücktransporte der Patienten zu erreichen, erfolgten Kooperationsvereinbarungen mit polnischen oder auch russischen Häusern.
(209) Obwohl sogar Inkassobüros beauftragt wurden, für die Begleichung ausstehender Klinikskosten bei polnischen Patienten in ihrer Heimat zu sorgen, hatte die Charité, nach Aussage der Leiterin des Justitiariats im April 1997, noch keinen Prozeß gegen zahlungsunwillige Sozialämter geführt, weil sich dieser „Aufwand wegen 30.000,- DM nicht lohne” und Sozialämter „alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Krankenhauskosten für dieses Patientenklientel nicht zu übernehmen”. (37)
2.5 Meldepflicht von Personaldaten
(210) Zunehmend größer wird die Unsicherheit von KlinikmitarbeiterInnen im Medizin- und vor allem Verwaltungsbereich, ob nicht Ausländer ohne Aufenthaltsrecht „gemeldet” werden müßten.
Verunsichert durch Pressemeldungen und veröffentlichte Meinungen, die zur Assoziation „illegal” gleich „strafbar” oder sogar „kriminell” führten, geht Krankenhauspersonal auf Distanz zu diesen Patienten.
(211) So haben Verwaltungsangestellte, nachdem sie Kenntnis von Patienten ohne Aufenthaltsrecht in ihrem Krankenhaus hatten, auch schon die Polizei geholt, um Fragen der Identität oder der Kostenträgerschaft zu klären.
Dem Verfasser sind Fälle von Kranken bekannt, die anläßlich ihres Krankenhausbesuches bzw. -aufenthaltes verhaftet wurden und danach in Abschiebungsgefängnisse kamen.
(212) Keine Gesetze gebieten dem Personal Patienten ohne Aufenthaltsrecht, welcher Behörde auch immer, am wenigsten der Ausländerbehörde oder Polizei, zu melden.
(213) Nach dem Ausländergesetz(38) muß zwar die zuständige Ausländerbehörde auf ihr Ersuchen hin von bestimmten öffentlichen Stellen dann unterrichtet werden, wenn diese vom Aufenthalt eines Ausländers, der weder eine erforderliche Aufenthaltsgenehmigung noch eine Duldung besitzt, Kenntnis haben.
Dies trifft weder für Krankenhäuser noch Arztpraxen zu.
(214) Bestimmte Behörden müssen sogar ohne Ersuchen derartige Meldungen und die Übermittlung personenbezogener Daten der entsprechenden Ausländer den Ausländerbehörden mitteilen. (39)
Leider hat der Gesetzgeber in diese Meldepflicht auch Sozial- und Jugendämter mit einbezogen.
Auch diese Verpflichtung betrifft nicht Krankenhäuser oder Arztpraxen.
3. Begutachtungen, Atteste
(215) (sg.fm.ck.) Begutachtungen und Atteste für den in Rede stehenden Kreis von Menschen haben, wenn sie mit der notwendigen professionellen Sorgfalt verfaßt werden, durchaus eine Bedeutung, wenn man sich vor Augen führt, daß es sich um eine lobbyarme Klientel handelt. Jede betreuende Person sollte sich allerdings über die begrenzte Wirksamkeit solcher Atteste und gutachterlichen Stellungnahmen im klaren sein, da das Arsenal der behördlichen Ablehnungsgründe beträchtlich ist.
(216) Das Problem von ärztlich/psychologischen Attesten u.ä. bewegt sich zwischen den Koordinaten von „Notwendigkeit” und „unterlassener Hilfeleistung”, zwischen „humanitären Erwägungen” und „Vorgaben” der Ausländerbehörde. Berufsethische Fragen kollidieren so leicht mit den Forderungen von Verwaltungsvorschriften. Die Unterstützung soll Schaden von einem kranken, traumatisierten oder aus anderen Gründen bedürftigen Menschen abwenden helfen.
(217) Die unterstützende Person sollte sich vor der Ausstellung eines Attestes u. ä. fragen, welches die Motive für die Unterstützung sind:
- Eigene Entlastung?
- Stehen Aufwand und Erfolgschancen in einer begründbaren Beziehung?
- Liegen die Voraussetzungen vor, eine Leistung zu erhalten?
- Handelt es sich allein um subjektive moralische Voraussetzungen?
- Wird der Klient möglicherweise auf eine unzumutbare Odyssee durch die Ämter getrieben?
- Hat er/sie die Kraft dazu? Soll das „inhumane System” insgesamt mittels eines Klienten entlarvt werden?
Hier ist Selbstreflexion gefordert, damit verbitterte Helfer vermieden werden. Als grundsätzliche Voraussetzung für den schriftlichen Kontakt mit Behörden ist eine vom Klienten unterschriebene Entbindung von der Vertraulichkeit oder professionellen Schweigepflicht notwendig.
(218) Im wesentlichen handelt es sich um Beurteilungen gesundheitlicher Fakten, die den Erhalt einer Leistung zu begründen suchen. Was zum Bereich der Behebung gesundheitlicher Störungen und Krankheiten oder zur Verhütung einer Verschlechterung gehört, ist vielfach Gegenstand intensiver Interpretationen. Dazu bedarf es fachlicher Kenntnisse und eines gewissen taktischen Geschicks beim Formulieren solcher Atteste. Die betroffene Klientel umfaßt im allgemeinen Asylsuchende, Asylberechtigte, Kriegsflüchtlinge und Nichtdeutsche mit unsicherem Status oder ohne Aufenthaltstitel, folglich solche Menschen, die erfahrungsgemäß eine Beratungsstelle oder kostenfreie Unterstützerorganisation aufsuchen, weil sie sich einen Rechtsanwalt nicht leisten können.
(219) Viel wäre geholfen, wenn es auch für diese Personen in unserem Rechtssystem einen garantierten Anspruch auf Rechtsbeistand gäbe, z.B. durch einen uneingeschränkten Anspruch auf Prozeßkostenbeihilfe.
(220) Für Nichtjuristen und die Betroffenen selbst sind die ständigen Gesetzesänderungen und Leistungskürzungen kaum zu verstehen. Allerdings werden Atteste u. ä. nicht primär mit Blick auf die Rechtslage ausgestellt. Sie haben vielmehr einen bestätigenden und anerkennenden Charakter.
Sie dokumentieren eine besondere gesundheitliche Lage und leiten erst sekundär eine Forderung daraus ab.
(221) Ausstellende Instanzen für Attestierungen aus gesundheitlichen Gründen sind ÄrztInnen und PsychologInnen.
BehördenmitarbeiterInnen verweisen Flüchtlinge an diese Berufsgruppen, weil sie sich selbst nicht in der Lage sehen, die gesundheitsbeeinträchtigenden Klagen von Flüchtlingen zu beurteilen. „Bringen Sie mir ein Attest.” heißt es dort oft, wenn Flüchtlinge Vergünstigungen oder gewünschte Leistungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen begründen.
(222) Diese Atteste stellen im allgemeinen lakonisch fest, um welche Diagnosen es sich handelt und leiten daraus normalerweise keine Forderungen ab.
Für die inhaltliche Bewertung der Atteste ist dann der Amtsarzt zuständig. Dieser läßt dann einen Termin zur Begutachtung, Prüfung und Untersuchung mitteilen. Dieses Verfahren hat ebensowenig mit ökonomischer Logik zu tun wie die Kostenfrage der Heimunterbringung, die oftmals um ein Vielfaches kostenaufwendiger ist als die Gestattung der Wohnungssuche auf dem freien Markt.
Man kann daher feststellen, daß die Ablehnung einer Diätzulage von DM 30,- einen Verwaltungsaufwand von mehreren Hundert Mark erfordert.
Aber hier geht es nicht um Logik, sondern um Disziplinierung, und die läßt sich der Rechtsstaat etwas kosten.
(223) Nun sind Rechtsverbindlichkeit und Rechtssicherheit hohe Güter, wäre da nicht der Ermessensspielraum. Es hängt nämlich erfahrungsgemäß maßgeblich vom zuständigen Sachbearbeiter, von seinen/ihren Kommunikationsfähigkeiten, von seiner/ihrer Einsichtsfähigkeit in die besonderen Umstände des Einzelfalls und wesentlich vom Votum des Amtsarztes ab, wie der Ermessensspielraum interpretiert wird.
(224) Es läßt sich leicht vorstellen, daß sprachliche Barrieren das größte Hindernis darstellen, ein Flüchtlingsanliegen überhaupt zu verstehen. Der Flüchtling habe im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht einen Sprachmittler mitzubringen, wenn er sich dem Amtsträger verständlich machen will, heißt es im Sozialamt Berlin-Weißensee. Gerade wegen der Sprachprobleme ist es oftmals unverzichtbar, daß sich attestierende Instanzen direkt an die zuständigen Behörden wenden. Denn vielfach entstehen schlicht Mißverständnisse, die leicht aufzuklären sind, oder auch laute Auseinandersetzungen, die in fataler Weise zu einem Polizeieinsatz führen können.
(225)
Beispiel:
Einem Patienten und Minenopfer, dem sieben Finger seiner Hände fehlten und der sich lautstark über die Nichtbewilligung eines bereits zugesagten Wechsels in eine ruhigere Wohnung beschwerte, wurde durch hinzugezogene Polizeibeamte so zugesetzt, daß ein Glasauge aus der Augenhöhle fiel und zersprang. Die folgende Klage des Minenopfers wegen Unverhältnismäßigkeit, Freiheitsberaubung und Körperverletzung im Amt wurde postwendend mit einer Klage wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt beantwortet. Die nachfolgende Behandlung der retraumatisierenden Einflüsse kostete sieben ärztliche Stunden und sieben Dolmetscherstunden.
3.1 Gründe für Attestierungen
(226) Die Gründe für Attestierungen liegen im wesentlichen in einem angegriffenen Gesundheitszustand, der im Heimatland eines Flüchtlings verursacht wurde, sich verschlechtert hat oder im Exilland neu entstanden ist. Dazu zählen im engeren Sinne angeborene oder erworbene Behinderungen, Folgen nach Folter oder Mißhandlung, Folgen von Übergriffen durch ausländerfeindliche Gewalt, Unfallfolgen und Erkrankungen, die eine Arztkonsultation erforderlich machen. Sie liegen ferner im seelischen Bereich, wenn Flüchtlinge z. B. von Suizidgedanken geplagt werden oder aufgrund ihrer Vortraumatisierung besondere soziale Umgebungsfaktoren brauchen.
(227) Atteste können erforderlich sein, wenn es darum geht, wegen regelmäßiger Behandlung in Gesundheitseinrichtungen eine Sozialkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel zu erhalten. Sie können erforderlich sein, wenn ein Flüchtling seinen Zuteilungsbezirk zu einer Spezialbehandlung in einer anderen Stadt verlassen muß. Hier ist zuweilen auch ein Umverteilungsantrag ärztlich/psychologisch zu begründen.
(228) Atteste können notwendig werden, wenn ein Unterbringungswechsel mit gesundheitlichen Argumenten erhärtet werden soll. Nach unserer Erfahrung kann es erforderlich sein, einen durch Folter Extremtraumatisierten aus der Abschiebehaft zur Diagnostik und eventuell zur Behandlung in ein Behandlungszentrum für Folteropfer zu holen. Atteste und professionelle Stellungnahmen können in Fragen der Reisefähigkeit und Behandlungsmöglichkeiten im Heimatland notwendig sein.
(229) Aus unserer Praxis sind ferner Stellungnahmen erforderlich für
- eine Einreise zum Zwecke der Behandlung (Giftgasüberlebende aus Südkurdistan)
- eine Familienzusammenführung
- eine Verschiebung der Anhörung vor dem Bundesamt (BAFL) aufgrund von Gedächtnis- und Kommunikationsstörungen.
(230) Eine unserer wesentlichen Aufgaben besteht darin, in Gutachten und ärztlich/psychologischen Stellungnahmen zu belegen, ob ein Mensch von Folter betroffen war.
Dies hat bedeutsame Auswirkungen im Asylverfahren, zur Beantwortung der Frage nach Abschiebehindernissen oder zur Prognose im Falle einer Abschiebung oder in Klagen vor nationalen und internationalen Gerichten.
(231) Ein eher unerfreuliches Feld sozialmedizinischer Atteste sind Bewertungen in Fragen der Diätzulage, der prothetischen Versorgung nach Verlusten von Gliedern oder der Zahnbehandlung.
(232)
Beispiel:
Einer bosnischen extremtraumatisierten Kriegsflüchtlingsfrau wurden sämtliche verbliebene Zähne wegen akuter Entzündungsgeschehen gezogen.
Die darauf mit Kostenvoranschlag beantragte Vollprothese wurde ein Jahr lang verzögert. Zuständigkeitsfragen und die ungeklärte Kostenübernahme verursachten eine Situation, in der die Frau ein Jahr lang überwiegend Breikost zu sich nehmen mußte, von den Folgen für das Selbstbewußtsein der Frau und die Ehebeziehung ganz zu schweigen.
Die notwendigen Schreiben, Telefonate und Interventionen beim behandelnden Zahnart sowie die Behandlung der seelischen Einbußen kosteten sechs ärztliche Stunden sowie vier Dolmetscherstunden.
(233) In eher seltenen Sonderfällen können zusätzliche Attestierungen zwingend sein. Sie werden hier nicht weiter aufgelistet, weil sich die Beispiele an der Praxis im Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin orientieren.
3.1.1 Kostenübernahme
(234) Das Problem der Kostenübernahme für die Behandlung eines Flüchtlings betrifft einmal die unmittelbare Behandlung, zum anderen die Begleitkosten wie An- und Abreise an den, bzw. vom Behandlungsort.
(235) Während Asylberechtigte, die nach dem BSHG behandelt werden, in ihren Leistungsansprüchen den deutschen Sozialhilfeempfänger gleichgestellt sind, werden Asylsuchende nach dem AsylbLG behandelt. Das bedeutet neben Leistungskürzungen und einer Sachleistungsversorgung auch eingeschränkte Ansprüche auf medizinische Versorgung.
Nur bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen oder wenn sie zur Sicherung der Gesundheit unerläßlich sind, werden die erforderlichen Maßnahmen gewährt.
(236) Mit der geplanten Gesetzesänderung soll Bürgerkriegsflüchtlingen jeder Anspruch auf eine medizinische Versorgung entzogen werden.
Mit dem Argument, sie könnten jederzeit ausreisen, soll diesen sowie einigen tausend anderen Flüchtlingen und ihren Angehörigen jeder Versorgungsanspruch verwehrt werden. Betroffen wären bundesweit ca. 250.000 Menschen, bei denen dann die Frage nach einer Kostenübernahme von gesundheitsfördernden oder -erhaltenden Maßnahmen entweder völlig negiert – oder in den Bereich der Ungebührlichkeit und Unangemessenheit verwiesen wird. Dies hätte in Zukunft ein strapazenreiches Gezerre zur Folge.
(237) Im Zentrum steht dann die Frage, was für eine gesundheitliche Förderung zwingend notwendig sei. Dabei spielt die Förderung der psychischen Gesundheit und eines sozialen Wohlbefindens ebenso keine Rolle wie eine gewisse Rücksicht auf Frauen in der nachgeburtlichen Periode.
(238)
Beispiel:
Erst intensives Nachhaken beim Jugendamt eines Berliner Bezirks konnte das zuständige Sozialamt dazu bewegen, überhaupt einen Krankenschein auszustellen.
Es handelte sich um das dreimonatige Kind eines Asylsuchenden, das Verdauungsprobleme hatte und an den Früherkennungsuntersuchungen noch nicht teilgenommen hatte. Erst eine Drohung mit einer Klage bewegte den zuständigen Sachbearbeiter zur Ausstellung eines Krankenscheins. Die entsprechende amtsübergreifende Auseinandersetzung (Telefonate, Atteste, sprachvermittelte Gespräche mit dem Vater des Kindes) kostete eine ärztliche Arbeitsstunde insgesamt.
(239) Der Krankenschein stellt für die ambulante Versorgung eine Art bewilligter Kostenübernahme dar.
In der Praxis sieht es freilich so aus, daß ein z.B. hochfieberhafter Flüchtling sich stundenlang in einem Sozialamt anstellen muß, um einen Krankenschein zu erhalten. Er kann selbstverständlich auch direkt zum Arzt gehen, muß dort jedoch zumeist DM 50,- hinterlegen, die er von seinem monatlichen Taschengeld von DM 80,- erst einmal beiseitelegen muß. Das bedeutet, daß im allgemeinen gesundheits- und würdebeeinträchtigende Hürden bestehen, eine Kostenübernahme in Form eines Krankenscheines für ambulante Leistungen im Akutfall zu erhalten.
(240) Eine Kostenübernahme für eine für erforderlich gehaltene stationäre Behandlung wird im Regelfall vom zuständigen Sachbearbeiter abgelehnt oder an den Amtsarzt weitergeleitet. Dieser prüft, ob eine zwingende Notwendigkeit besteht.
(241) Es empfiehlt sich, mit dem Amtsarzt Kontakt aufzunehmen und mündlich zu begründen, was die Hintergründe für eine operative Behandlung sind, welche Beschränkungen seines Alltags ein Flüchtling ertragen muß, wenn der Eingriff abgelehnt wird.
Dabei handelt es sich nach unserer Erfahrung um rekonstruktive Eingriffe, z. B. Trommelfellplastiken oder Nachoperationen bei ungenügend ausgeführten Amputationen u.ä., die den Gebrauchswert eines Organs erhöhen oder Verschlechterungen (Cholesteatom, chronische Otitis media) vorbeugen sollen. Hier sind zumeist Auseinandersetzungen mit Behördenvertretern zu erwarten.
(242) Lebensbedrohliche oder mit massiven Schmerzzuständen verbundene Erkrankungen erfordern unabhängig von einer genehmigten Kostenübernahme eine Aufnahme in stationäre Abklärung (siehe 2.3.1.1). Das gebietet schon das ärztliche Ethos.
Das gleiche gilt für schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen, die mit quälender Unruhe, Aggressivität oder Suizidalität verbunden sind.
(243) Erhebliche Schwierigkeiten ergeben sich, wenn man die Übernahme der Kosten für eine An- und Abreise erstattet bekommen möchte, wenn die Behandlung außerhalb des Zuteilungsbezirks stattfinden muß.
(244)
Beispiel:
Eine kurdische Familie, die in einer ländlichen Region in Thüringen untergebracht ist, hat zwei Kinder, die wegen Tuberkulose in einem 90 km entfernten Krankenhaus behandelt werden müssen.
Die Kinder sind 5 und 7 Jahre alt und brauchen den regelmäßigen Besuch eines Elternteils. Nach der stationären Behandlung werden weitere Nachuntersuchungen erforderlich. Der Vater beantragte die Übernahme der Reisekosten. Sie wurde abgelehnt. Eine umfassende ärztliche Stellungnahme begründete die Notwendigkeit des elterlichen Besuchs für den Verlauf der mehrmonatigen stationären Behandlung. Dabei mußte erheblicher Druck angewandt werden, denn es lag bereits ein Attest des Hausarztes vor, das vom zuständigen Sozialamt ignoriert wurde. Telefonate und Stellungnahme kosteten eine ärztliche Arbeitsstunde.
3.1.1.2 Atteste und Stellungnahmen für eine Behandlung
(245) Für den Kreis der von Folter betroffenen Flüchtlinge ergibt sich die Notwendigkeit, zur Diagnostik in Zentren zu reisen, die sich auf die Folgen von Folter spezialisiert haben. Bevor ein Patient zur Behandlung angenommen wird, ist erst einmal abzuklären, ob die Voraussetzungen vorliegen. Sind diese gegeben, empfiehlt sich ein Umverteilungsantrag, der zudem anwaltlich gestützt werden sollte. Die Übernahme der Reisekosten für die ersten abklärenden Sitzungen werden im allgemeinen abgelehnt. Einzelne Amtsärzte haben in der Vergangenheit zugestimmt, daß die Reisekosten übernommen werden.
(246) Es ist sogar bei kontinuierlichen Behandlungen von angereisten Patienten entweder der Daueraufenthalt in Berlin mit der Übernahme der Reisekosten für Besuche bei der Familie oder eine Bahncard genehmigt worden.
Das setzte jedoch voraus, daß die entscheidenden Amtsärzte von der Notwendigkeit der Behandlung überzeugt waren oder sich anhand von Infomaterial ins Bild setzten.
3.1.1.3 Atteste für medizinisch indizierte Hilfs
(247) Im allgemeinen handelt es sich um Stützapparate oder orthopädisches Schuhwerk, die als integraler Bestandteil einer fachgerechten Behandlung anzusehen sind. Hier sind fachärztliche Begründungen erforderlich.
Sie werden von amtsärztlichen Fachärzten geprüft.
Dabei wird vielfach darauf abgehoben, daß der Betroffene schon Jahre ohne diese Hilfsmittel ausgekommen sei, ja sogar seine Flucht ohne diese korrigierenden Maßnahmen überstanden habe.
(248) Aus der Begründung des Attestes für orthopädische Hilfsmittel muß hervorgehen, daß es sich um eine anerkannte Maßnahme im Rahmen einer Gesamtbehandlung handelt und nicht in einer wünschenswerten größeren Annehmlichkeit begründet liegt, obwohl die Grenzen nicht immer leicht zu ziehen sind.
(249) Man kann davon ausgehen, daß von Seiten des Amtes lediglich die jeweils kostengünstigste Variante bewilligt wird, was zuweilen mit erheblichen Nachteilen für den Patienten verbunden ist. Es gibt einige Beispiele für die Übernahme der Kosten, wenn eine externe Spende zur Verfügung stand und dem Amt angeboten werden konnte, daß ein Teil der Kosten daraus gedeckt wurde.
3.1.1.4 Atteste für Diätzulagen
(250) Solche Atteste haben nur dann einen Erfolg, wenn sie in Fällen eines Krebsleidens, einer anderen konsumierenden Erkrankung, einer Stoffwechselerkrankung oder einer rezidivierenden Erkrankung des Magen-Darm-Traktes ausgestellt werden. Auch hier prüft der Amtsarzt die Berechtigung.
Negative Einflüsse auf das Krankheitsgeschehen, die in der Verantwortung des Patienten liegen, sollten zum Zeitpunkt der Beurteilung weitgehend ausgeschaltet werden.
(251) Das gleiche gilt sinngemäß auch für Anträge, die eine Zuordnung in die Schwerbeschädigtenkategorien fordern.
3.1.1.5 Atteste für den Wechsel aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine Wohnung
(252) Solche Bescheinigungen haben zunächst zu berücksichtigen, welche Krankheitsgeschehen durch eine Heimunterbringung verschlechtert werden und welche Verwaltungsvoraussetzungen vorliegen müssen, damit ein Heimwechsel zustande kommen kann.
(253) Bei einem Heimwechsel lohnt es sich, auf die besseren Umstände im neuen Heim Bezug zu nehmen. Dabei ist es oft hilfreich, sich selbst einen Eindruck von der bisherigen und der angestrebten Unterkunft zu verschaffen.
Es ist daher auch auf die verbesserten Genesungsmöglichkeiten zu verweisen. Dazu gehören neben der erwünschten Ruhe auch sprachliche Kommunikationsmöglichkeiten und die Versorgung und Betreuung durch Dritte.
(254)
Beispiel:
Ein schwertraumatisierter Flüchtling wird von regelmäßigen Alpträumen geplagt. Er schreit fast in jeder Nacht im Schlaf. Seine Zimmermitbewohner sind gereizt, weil sie um den Schlaf gebracht werden.
Die Furcht vor der Nacht führt bei dem Flüchtling zu Übermüdung und Konzentrationsstörungen. Sie führt ferner dazu, daß er nachts eher spazierengeht, um seine Mitbewohner nicht zu stören. Gereiztheit ist die Folge der konstanten Schlafstörungen.
Er beantragt den Wechsel in ein Einzelzimmer. Solche stehen nicht zur Verfügung. Daher wünscht er, der sich wegen massiver posttraumatischer Belastungsstörungen in regelmäßiger Behandlung befindet, den Wechsel in eine Wohnung. Sein Begehren wird mit der Begründung abgelehnt, daß er sich am Zuteilungsort noch nicht ein Jahr aufhalte. Erst danach habe sein Antrag die formalen Voraussetzungen. Als das Jahr abgelaufen ist, erneuter Antrag. Erneute Ablehnung. Es folgt ein Widerspruch, der eine amtsärztliche Untersuchung nach sich zieht.
Zur Untersuchung liegt eine ärztliche Stellungnahme vor. Sie wird ergänzt um eine schriftliche Darstellung der aktuellen Beschwerden. Es erfolgt eine Ablehnung mit der Begründung, alte Menschen in Altenheimen hätten gleichfalls Schlaflosigkeit in Kauf zu nehmen.
Eine ärztliche Arbeitsstunde, eine Dolmetscherstunde.
(255) Wir haben erlebt, daß Gesuche nach Unterbringungswechsel bei der amtsärztlichen Untersuchung zu Verständigungsschwierigkeiten führten, so daß in den begründenden Attesten sehr detaillierte Angaben enthalten sein sollten. Wir haben ferner erfahren, daß die urteilenden Amtsärzte nichts von den Bedingungen der Heimunterbringung wissen oder ahnungslos sind, was die Symptomatik nach Folter betrifft. Hier können direkte telefonische Vorgespräche und die Übermittlung notwendiger Informationen sehr hilfreich sein.
(256) Wenn der attestierende Arzt/Psychologe der Auffassung ist, daß ein Unterbringungswechsel wesentlich zur Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse eines Patienten beiträgt, dann sollte er auch Widerspruch einlegen und diesen begründen. Der zeitliche Aufwand ist zwar unverhältnismäßig hoch, dagegen belegt ein schweigendes Abfinden mit einer Ablehnung, daß es so ernst nicht gemeint war mit dem Attest.
Daher sollte zuvor geprüft werden, ob die fachliche Begründung so stringent ist, daß sie einen Widerspruch übersteht.
(257) Im Jahre 1996 hat das Verwaltungsgericht Göttingen geurteilt, daß Extremtraumatisierte (hier: Folterüberlebende) nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen müssen. (40)
Etliche ärztliche Gutachten haben das Gericht davon überzeugt, daß die vom Kläger erduldeten Folterungen zu erheblichen körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen geführt hatten.
Obwohl das Gesundheitsamt eine Unterbringung des Klägers außerhalb einer Sammelunterkunft nicht für medizinisch erforderlich hielt und ein Gutachten der neurologischen Abteilung der Uniklinik den Unterbringungswechsel lediglich empfahl, jedoch nicht zwingend geboten sah, erkannte das Gericht, daß dem Kläger gesundheitliche Beeinträchtigungen für den Fall drohen, daß er in der Gemeinschaftsunterkunft bleiben muß. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit rechtfertige die Umsetzung des Klägers in eine Privatunterkunft schon deshalb, weil sie medizinisch wünschenswert sei. Die Verarbeitung des Erlebten gelänge in einer privaten- besser als in einer Gemeinschaftsunterkunft, sofern sie überhaupt möglich sei.
3.1.2 Reise- und Flugfähigkeit
(258) Hier handelt es sich um die Beurteilung von Reisefähigkeit im Falle einer Abschiebung in das Heimatland eines Flüchtlings.
(259) Grundsätzlich ist ein ärztliches Mitwirken am „Ruhigspritzen” eines sich potentiell widersetzenden Abzuschiebenden als unethisch abzulehnen, da ein „Ruhigspritzen” oder Verabreichen von sedierenden Cocktails keine medizinische Indikation im Rahmen eines Verwaltungsaktes hat.
Die Komplikationen sind zudem schlecht prognostizierbar, weil die gesundheitlichen Voraussetzungen nie vollständig oder hinreichend bekannt sind.
(260) Reisefähigkeit ist z. B. dann zu verneinen, wenn eine begründbare Suizidalität vorliegt. Gewisse Herz-Kreislauferkrankungen schließen zudem eine Flugfähigkeit aus. Ärztliche Stellungnahmen zu diesen Komplexen werden vom polizeiärztlichen Dienst überprüft (siehe 3.3.1).
(261) Die Angst eines Flüchtlings vor der Abschiebung kann vielfältige Ursachen haben. Es ist daher in der Stellungnahme ausdrücklich darauf zu verweisen, daß die Verantwortung beim polizeiärztlichen Dienst liegt und dieser im Falle einer Komplikation, auf die zuvor hingewiesen war, zur Verantwortung gezogen wird.
Es ist ratsam, zur Untersuchung eine protokollierende Begleitperson mitzuschicken.
(262) Im Zusammenhang mit angedrohten Abschiebungen geht es zuweilen um die Frage, ob im Heimatland eine qualifizierte Weiterbehandlung möglich sei. Da muß man sich schon sachkundig machen. Hinweise auf sachkundige Quellen befinden sich im Anhang der Broschüre (vgl. auch 3.3.3).
(263) Auch die Frage, ob eine begonnene Psychotherapie fortgeführt werden könne, sollte von uns wiederholt beantwortet werden.
(264) Grundsätzlich bergen gewaltsame, von Außeninstanzen bewirkte Therapieabbrüche Gesundheitsrisiken für den Patienten. Bei latenter Suizidalität können tödliche Folgen entstehen. Ärzte und Therapeuten sollten keine Möglichkeit ungenutzt lassen, sich einem Abbruch zu widersetzen. Notfalls ist die entsprechende Standesorganisation hinzuzuziehen.
Traumatisierte Flüchtlinge haben im Falle einer Abschiebung mit retraumatisierenden Konsequenzen zu rechnen. Für das extrem traumatisierte Kontingent bosnischer Kriegsflüchtlinge wurde explizit eine Verschiebung der Rückführung gebilligt, wenn nachweisbar war, daß die Betroffenen retraumatisierende Einflüsse fürchten müssen.
(265) In der Weisung Nr. 92 der Berliner Senatsinnenverwaltung vom 26.09.1996 über die Rückführung von bosnischen Kriegsflüchtlingen wurde dazu ausgeführt::
„Traumatisierte Personen, bei denen die Traumatisierung einen Krankheitswert darstellt, erhalten die Möglichkeit einer Behandlung und dementsprechend längstens bis zum Abschluß der Behandlung eine Duldung.
Die Beurteilung, ob eine Behandlung erforderlich ist, orientiert sich an den vorgelegten Attesten und an der Stellungnahme der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales („Plausibilitätsprüfung“).
Das Attest muß von folgenden Personen/Institutionen ausgestellt sein:
- Niedergelassener Facharzt,
- Psychologe/Psychotherapeut,
- Krankenhaus,
- Sozialpsychiatrischer Dienst,
- Behandlungszentrum für Folteropfer
- oder einer speziell benannten Einrichtung zur Beratung und Unterbringung von traumatisierten Personen.”
(266) (ev) Mit Schreiben vom 25.3.1998 teilte die Leitung von LaGeSo jedoch dem Behandlungszentrum für Folteropfer mit, man könne derartige Plausibilitätsprüfungen aus rechtlichen und personellen Gründen nicht mehr vornehmen. Wer, bzw. welche Senatsdienststelle dies nun übernehme und ob dazu überhaupt noch die Notwendigkeit bestehe, blieb bis zur Drucklegung ungeklärt. Ebenso konnte noch nicht geklärt werden, welche aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen die Ausländerbehörde aus den nun ihr direkt zur Entscheidung anstehenden, begutachteten Fällen gezogen hat.
3.2 Aufbau von Attesten und ärztlichen Stellungnahmen
(267) Generell besteht in Attesten eine innere Abwehr gegen eine umfangreiche Darstellung eines Krankheitsgeschehens gegenüber einem Sachbearbeiter.
Warum, so fragt man sich, soll ich einem Sachbearbeiter in einem Amt das ausbreiten, was diese Person möglicherweise gar nicht beurteilen kann?
Schreibt man jedoch lakonisch eine Diagnose oder gar nichts, so urteilt dieser Sachbearbeiter ohne Kenntnisse über Gesundheitsfragen.
Daher sollte eine Mischung zwischen medizinischer Fachterminologie und in Deutsch gehaltener Erläuterung angewandt werden.
(268) Da diese Atteste oftmals an den Amtsarzt weitergereicht werden, sollte auch dessen Hintergrundwissen angesprochen werden.
(269) Atteste beschreiben also einen individualgeschichtlichen Hintergrund, dann die aktuellen Beschwerden. Sie sollten zu gebräuchlichen Diagnosen zusammengefaßt werden. Dann schließt sich die Forderung an. Danach ein Abschnitt, was im Falle einer Ablehnung eintreten könnte, also eine Prognose.
Der Ton kann im ersten Attest freundlich und bittend sein, sollte zugleich betonen, daß der Schreiber über die entsprechenden Kenntnisse, auch der Verwaltungspraxis, verfügt. Man sollte ferner immer einen Termin für eine schriftliche Antwort setzen.
Sollte eine weitere Stellungnahme erforderlich sein, so ist der Ton drängender zu halten und die angemessene Verantwortlichkeit des Sachbearbeiters für die Gesundheit des Flüchtlings herauszustreichen. Das führt im allgemeinen dazu, daß der Vorgesetzte herangezogen wird.
(270) Stellungnahmen fallen dagegen umfangreicher aus. Sie sollen bereits eine Auseinandersetzung mit dem Amtsarzt einläuten. Sie können um zusätzliche Dokumente, wie andere ärztlich/psychologische Atteste, ergänzt werden. Sie sollen eine Ablehnung schwierig machen und schon betonen, daß der ausstellende Arzt auch den Widerspruch mitträgt.
Es obliegt dann auch der betreuenden Person, die Fristen zu wahren und Formulierungshilfe zugeben, da Flüchtlinge sich im Dschungel der Verwaltungsvorschriften nicht auskennen. Deutsche können dabei erkennen, daß sie gegenüber den Ämtern gleichfalls zu unverständigen Fremden werden.
(271) Der attestierende Arzt/Therapeut sollte sich ferner klarmachen, daß er im Rahmen eines Gerichtsverfahrens als sachverständiger Zeuge geladen werden kann, daß folglich sein Berufsethos und seine Glaubwürdigkeit öffentlich geprüft wird.
3.3 Überprüfung von Attesten
(272) (ev) Behörden sind in beängstigender Weise bestrebt, auf den von ihnen einmal getroffenen Entscheidungen zu beharren. Außerdem werden etwaige Ermessensspielräume nicht ausgenutzt, ihre Entscheidungen seien per se objektiv – somit beständen keine Korrekturnotwendigkeiten.
Je massiver Korrekturen von Verwaltungsentscheidungen ausfallen müßten, desto eher ist Widerstand zu erwarten.
(273) So sind denn auch einmal getroffene Abschiebungs- oder Ausweisungsentscheidungen nur selten zu verhindern oder auch nur auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, selbst wenn medizinische Belange dafür sprechen. Fälle, bei denen die Ausländerbehörde ärztliche Atteste überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt oder sie entsprechend beachtet, nehmen in den letzten Jahren auffallend zu.
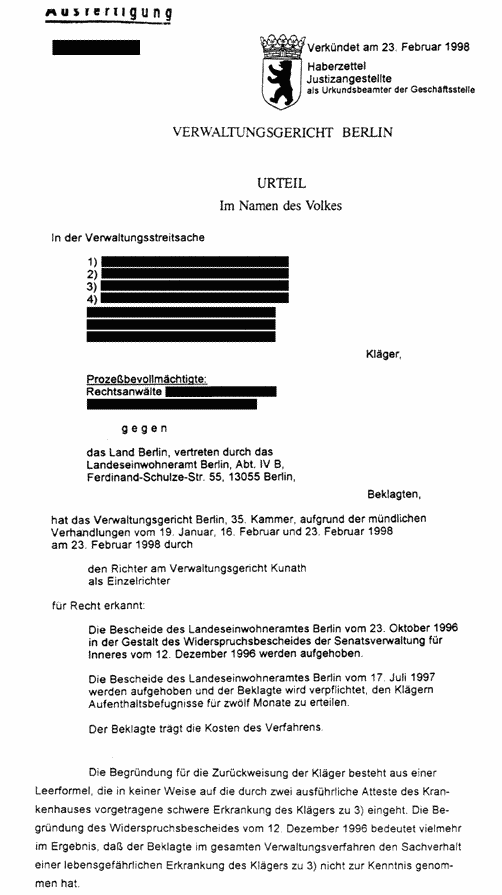
Der Ausländerbehörde wurde vorgeworfen, den Sachverhalt einer lebensgefährlichen Erkrankung eines Ausländers während des gesamten Verwaltungsverfahrens nicht zur Kenntnis genommen zu haben.
3.3.1 Überprüfung durch den polizeiärztlichen Dienst
(274) Die von niedergelassenen Ärzten oder Kliniken für Patienten ausgestellten Atteste, die auf Gefahren für Leben und Gesundheit hinweisen wenn es denn zur Abschiebung käme, werden zu den Akten der Ausländerbehörde genommen.
Jedoch werden sie nur selten beachtet oder die entsprechenden Schlüsse daraus gezogen.
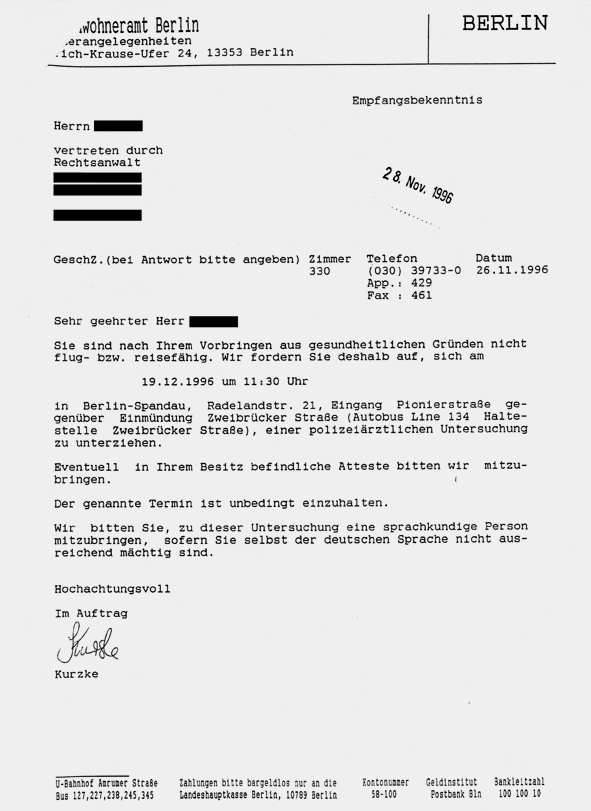
Polizeiärztliche Untersuchung
Vorladung eines Kranken, der abgeschoben werden sollte, zur polizeiärztlichen Untersuchung.
Der Abzuschiebende wird dann – wenn er sich nicht schon im Abschiebungsgefängnis befindet – zur „Überprüfung seiner Behauptung“ (nicht der des Arztes!), eine Abschiebung verbiete sich aufgrund schwerer Erkrankungen oder geplanter stationärer Behandlung oder Suizidalität oder mangelnder bzw. fehlender Weiterbehandlung im Herkunftsland uvm. – zum Polizeiärztlichen Dienst einbestellt.
(275) Auftraggeber für diese Art der „Objektivierung” zuvor ausgestellter Atteste ist die Ausländerbehörde. Die Atteste sind die einzigen Quellen, aus denen die Vielzahl der medizinischen Gründe, die gegen eine Abschiebung sprechen, hervorgehen.
Die „Objektivierung” durch den Polizeiarzt beruft sich dann auf eine einmalige Untersuchung, evtl. noch auf Laboruntersuchungen. Dolmetscher werden fast nie gestellt und Kontakte mit vorbehandelnden Kliniken oder Ärzten in Praxen gemieden.
(276) Die ärztliche Begutachtung wird letztlich nur auf die Beantwortung der Frage der Ausländerbehörde reduziert, ob Gründe für eine Reiseunfähigkeit als Abschiebungshindernis vorliegen. Allein das Ergebnis – das heißt die Antwort auf diese Frage – wird dann der Ausländerbehörde mitgeteilt.
Vorbehandelnde Ärzte erfahren fast nie von diesem Vorgängen und kennen dann natürlich auch nicht den Ausgang.
Stellt nun der Polizeiärztlichen Dienst Reisefähigkeit fest, kann die Ausländerbehörde die Abschiebung vollziehen und tut dies auch.
(277) Die hier geschilderte Praxis ist durch Rechtsanwälte und Personen aus Beratungsstellen vielfach belegt, auch sind einige Ärzte, Juristen und die Betroffenen selber dafür Zeugen.
(278) Bis zur Drucklegung der Broschüre schlugen alle Versuche von Mitgliedern des Vorstands der Ärztekammer Berlin – auch ihrer Beauftragten für Menschenrechte und Vertretern des Flüchtlingsrates – fehl, Gespräche mit dem Polizeiärztlichen Dienst über diese Probleme zu führen.
(279) So ist es auch nicht zur Klärung der Behauptung der Senatsverwaltung für Inneres von Berlin als Aufsichtsbehörde des Polizeiärztlichen Dienstes gekommen, die Ausländerbehörde prüfe auch die Voraussetzungen der Erteilung einer „Duldung wegen mangelnder medizinischer Versorgung im Heimatstaat” und bei der „polizeiärztlichen Einschätzung der Reisefähigkeit werde stets auch unter Einbeziehung der voraussichtlich vorhandenen und medizinischen Behandlungsmöglichkeiten am Zielort beurteilt.” (41)
(280) Alle Erfahrungen strafen diese Behauptung Lügen und selbst Mitarbeiter des Polizeiärztlichen Dienstes äußerten sich dazu gegensätzlich – sie hätten nur die Frage nach der Reisefähigkeit zu beantworten, mehr nicht.
Sie würden die Leute auch nicht abschieben, dies mache ja die Ausländerbehörde. Daß sie diesen Vorgang durch ihr Tun jedoch ermöglichen, steht auf einem anderen Blatt.
(281) So sind denn auch ganz konkrete Menschen bekannt, die nach polizeiärztlicher Untersuchung z. B. für reise- oder auch flugtauglich erklärt und abgeschoben wurden oder werden sollten, obwohl in ihren Heimatländern die weitere medizinische Versorgung nicht sichergestellt oder unmöglich war.
Beispiele:
- So erging es einem schwer Herzkranken mit Anfällen von Angina pectoris, der in ein südamerikanisches Land abgeschoben werden sollte und
- einem jugendlichen insulinpflichtigen Diabetiker aus Syrien.
- Ein nur mit Heilnahrung lebensfähiges Kind sollte in ein ukrainisches Dorf abgeschoben werden.
- Ein halbseitig gelähmter, an den Rollstuhl gefesselter und auf fremde Hilfe angewiesener Mann nach Vietnam.
- Dem Tode nahe Menschen mit dem klinischen Vollbild der AIDS-Erkrankung sollten in afrikanische Länder und Suchtkranke während der Methadonsubstitutionstherapie in die Türkei zurückkehren.
- Selbst bei suizidgefährdeten Menschen wurde nicht von der Abschiebung Abstand genommen. In jedem der Fälle lagen ausführliche und warnende medizinische Gutachten ihrer behandelnden Ärzte vor.
- Aus dem Attest eines Arztes:
„…deshalb beinhaltet die Abschiebung das Risiko einer schwerwiegenden Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes mit der Gefahr des Todes…” - Dagegen verneinte eine Polizeiärztin die attestierte Reiseunfähigkeit. Die Person befände sich in einem ausgezeichneten Zustand und könne einen Flug von 6 Stunden unbeschadet überstehen.
- In einem anderen Fall lautet es im Attest einer Ärztin:
„… sie leidet an Depressionen mit psychischer Dekompensation … sie ist nicht in der Lage, sich allein zurecht zu finden…” - Und einer anderen Ärztin zum gleichen Fall:
„…bei einer Rückführung in ihr Heimatland wäre mit einer dramatischen Verschlimmerung der Symptomatik zu rechnen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werde sie in einem handlungsunfähigen regressiven Zustand oder in eine suizidale Krise geraten…sie ist nicht reisefähig…”
Dagegen wird in der polizeiärztlichen Begutachtung festgestellt: „Die als Befindlichkeitsstörungen (!) zu bewertenden Beeinträchtigungen stellen kein grundsätzliches Reisehindernis dar”.
3.3.2 Überprüfung durch Amtsärzte oder andere Ärzte
(282) Die vom amts- und vertrauensärztlichen Dienst der Gesundheitsämter auf Wunsch von Ausländern erstellten Gutachten (hier: Überprüfung der Reisefähigkeit) werden nicht in das ausländerrechtliche Verfahren eingeführt, weil sie nicht durch die Ausländerbehörde initiiert wurden. (42)
(283) Dennoch werden, entweder unter bewußter Negierung der eigenen Verfahrensweise oder aus Unkenntnis von der Ausländerbehörde ärztliche Stellungnahmen zur Frage der Reisefähigkeit durch Dritte eingeholt.
So obliegt es einem niedergelassenen Frauenarzt im Auftrag der Polizei entsprechende Stellungnahmen abzugeben, wenn es sich um Schwangere oder gynäkologisch Erkrankte handelt.
Auch die im Abschiebungsgewahrsam tätige Ärztin und ärztliche Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten, auch bezirkliche Amtsärzte, treten in Funktion, wenn die Ausländerbehörde bei vorliegenden Attesten Korrekturbedarf sieht.
3.3.3 Zunehmende Beeinflussung medizinischer Belange durch Behörden
(284) Bestimmte ausländerrechtlich vorgegebene Ziele können für Ausländerbehörden schwerer erreicht werden, wenn es sich dabei um kranke Ausländer handelt – so die Ablehnung der Verlängerung eines Aufenthaltsrechtes, die Verweigerung eines festen Aufenthaltstitels oder die Durchführung einer Abschiebung.
(285) Sind Ärzte als Mitarbeiter der Polizei oder als Amtsärzte an Belange der Ausländerbehörde gebunden, finden in zunehmendem Maße und ganz offensichtlich Einmischungsversuche durch sie und andere Mitarbeiter der Ausländerbehörde in Tätigkeitsfelder von niedergelassenen- und Klinikärzten unter Einengung der freien Entscheidungsmöglichkeiten ihrer Patienten statt.
Beispiele:
(286) So wurde im Fall der geplanten Abschiebung eines Kranken die Stellungnahme des Therapeuten, daß sich hier die Abschiebung aus medizinischen Gründen verbiete, von der Ausländerbehörde durch eine wenig differenzierte, pauschale Stellungnahme des Auswärtigen Amtes zur ärztlichen Versorgung vor (Abschiebe-) Ort außer Kraft gesetzt.
(287) Auch wurde behauptet, in einer bosnischen Stadt sei eine schwere – fast immer tötliche – Stoffwechselerkrankung eines Kindes behandelbar, obwohl die infrage kommenden Kliniken das Gegenteil bestätigten.
(288) In einem anderen Fall berief sich die Ausländerbehörde in Berlin mit ihrer Abschiebungsandrohung auf die Auskunft des Auswärtigen Amtes, „AIDS sei in Kenia bekannt und könne dort auch therapiert werden“. Vor Ort im Auftrag der Kirche tätige Ärzte bestätigen dagegen, was alle – auch die Ausländerbehörde – wissen: die betreffende Person könne höchstens zum Sterben nach Kenia kommen.
(289) Selbst die Deutsche Botschaft in Vietnam mußte auf Anfrage zugeben, daß wohl die Aussage des Auswärtigen Amtes zur medizinischen Versorgung im Land, wie der Ausländerbehörde mitgeteilt, nicht stimme.
(290) Dies sind Beispiele dafür, wie wichtig die Quellenangaben der im eigenen Attest angeführten Fakten sind, wenn sich die Ausländerbehörde bei ihren Entscheidungen nur auf das vermeintlich schwere Geschütz einer Stellungnahme des Auswärtigen Amtes beruft. Meist gleichen diese einer „Gefälligkeitsstellungnahme”.
(291) Wie soll auch der jeweilige deutsche Botschaftsdienst zu dezidierten Erkenntnissen über die medizinische Versorgung des Landes, in dem er tätig ist, kommen und warum soll er diese wahrheitsgemäß als meist desolat darstellen, wenn damit Belange dieses Landes verletzt werden könnten?
Um so wichtiger sind Hinweise in den eigenen Attesten, auf welchen Quellen die angeführten Aussagen beruhen. Hinweise auf entsprechende Institutionen befinden sich im Anhang der Handreichung.
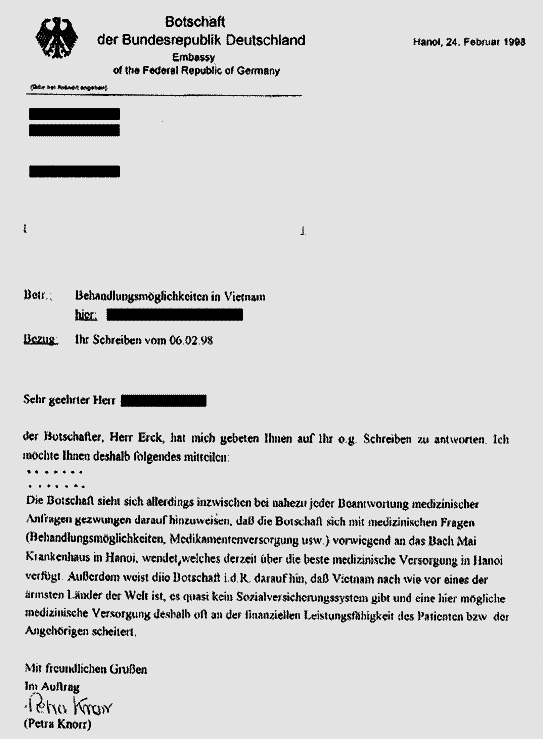
Auszug aus einer Stellungnahme der Deutschen Botschaft in Vietnam zur medizinischen Versorgung im Land.
(292) Erfahrungen lassen die Vermutung zu, daß von der Berliner Ausländerbehörde keine weiteren Quellen für ihre Entscheidungsprozesse benutzt werden, wenn es gilt, kranke Ausländer abzuschieben.
(293) Wieweit die Einflußnahme von Behörden geht, wenn eine Abschiebung zu realisieren, können noch folgende Beispiele verdeutlichen:
(294) Die Berliner Ausländerbehörde teilt einem schwer an Diabetes erkrankten Vietnamesen (nicht etwa seinem Arzt!) mit, die bisher bewährte Therapie solle auf ein Insulinpräparat umgestellt werden, das in Vietnam zu besorgen ist. Natürlich geht das alles nur während eines Klinikaufenthaltes. Was dazu der Kostenträger sagt, wurde von der Behörde nicht erfragt. Erstrecht spielt es keine Rolle, was der Patient darüber denkt und ob er dieses Risiko eingehen wollte. Es wurde auch einfach unterstellt, er könne sich dann als mittelloser Mensch dieses Präparat nach der Abschiebung auf dem freien Markt in Vietnam besorgen.
(295) Von der Ausländerbehörde wurde einem heroinabhängigen Ausländer auferlegt, sich noch vor seiner Abschiebung einem Methadonentzug unter ärztlicher Kontrolle zu unterziehen. Der gute Zustand der zusätzlich vorliegenden AIDS-Erkrankung würde dann auch einer Abschiebung nicht entgegenstehen.
(296) Wohlgemerkt – diese „Auflage” stammte nicht etwa aus berufenem ärztlichen Munde – sie war das Produkt der entfesselten Exekutive der Verwaltung. Weder der behandelnde Arzt wurde zuvor befragt oder im Nachhinein informiert, erstrecht nicht der Betroffenen selber. Vielleicht wollte man ihm vor der Abschiebung nur noch eine Wohltat zukommen lassen?
(297) Einerseits geht wohl die Ausländerbehörde davon aus, daß sich die betroffenen Ausländer nicht auf derartige Risiken einlassen werden, andererseits taxiert sie die Hilflosigkeit der Ärzte und ihre mengelnde Protestbereitschaft richtig ein. Damit steht ihrem Ziel der „weichen Abschiebung” nichts mehr entgegen. Wie dann bei tötlichem Ausgang einer Abschiebung die Haftungsfrage der verantwortlichen Mitarbeiter zu beurteilen ist, bedarf juristischer Klärung.
Allerdings wird sich wohl kein Richter finden, weil kein Kläger (mehr) da ist.
4. Abschiebungshaft
(298) (iga) Abschiebungshaft ist das letzte Glied in einer Reihe von Gesetzen und Verwaltungsverfahren zur Abschottung Deutschlands gegen Menschen in Not. Um das Verschweigen und Verstecken der Auswirkungen dieser Politik aufzubrechen, haben wir uns als „Initiative gegen Abschiebehaft“ im April 1994 zusammengetan. Gemeinsam arbeiten wir seitdem zur Situation von Flüchtlingen und zu den Zuständen, die in den Berliner Abschiebungshaftanstalten herrschen.
(299) Die Gefängnisse, in denen in Berlin die Abschiebungshaft durchgeführt werden, sind der „Abschiebungsgewahrsam Köpenick” in der Grünauer Straße mit ca. 350 Plätzen und der „Polizeigewahrsam” in der Moabiter Kruppstraße mit Platz für etwa 150 weibliche Häftlinge.
(300) Abschiebungshaft ist keine Strafhaft. Der §57 des Ausländergesetzes nennt sie „Vorbereitungshaft” oder „Sicherungshaft”, vorbereitet und gesichert werden soll die Abschiebung, die häufig wegen fehlender Personaldokumente oder laufender Verfahren noch nicht durchgeführt werden kann. Der größte Teil der Inhaftierten wird allerdings nach einiger Zeit der unsinnigen Haft wieder entlassen.
(301) Die Haftbedingungen dieser Menschen, denen keine Straftaten vorgeworfen werden, sind zwar rechtlich korrekt geregelt, aber trotzdem weitgehend skandalös zu nennen. Bis zu 18 Monaten weggeschlossen hinter Gittern, gibt es für die Inhaftierten keine Beschäftigungsmöglichkeiten, Gespräche mit Besuchern sind nur durch die Trennscheibe erlaubt, täglich gibt es nur eine Stunde Hofgang, weder Feuer für die Zigarette noch heißes Wasser für Tee oder Kaffee ist ohne die Wärter zu erhalten … – und am Ende wird dem Häftling noch eine dicke Rechnung präsentiert: Pro Tag in der Abschiebungshaft werden ihm DM 96,60 aufgebrummt.
4.1 Medizinische Versorgung
4.1.1 Polizeiärztlicher Dienst, angestellte Ärztin, Sanitäter
(302) (bg) Im Abschiebungsgewahrsam Berlin-Köpenick wird die medizinische Versorgung durch den polizeiärztlichen Dienst abgedeckt. Es gibt im Haus eine eigene Sanitätsabteilung, in der rund um die Uhr Sanitäter anwesend sind, und eine Ärztin ist mit voller Stelle dort eingesetzt.
(303) Die medizinische Betreuung der Gefangenen des vor kurzem Abschiebungsgewahrsams Kruppstraße wird von der Ärztin zusätzlich übernommen.
(304) Die Abschiebungshäftlinge können sich bei gesundheitlichen Beschwerden an die Polizeiangestellten auf den Etagen wenden und die Vorführung bei Sanitäter oder Ärztin verlangen, was in der Regel auch klappt, obwohl es gelegentlich auch Beschwerden darüber gibt. Bei besonderen gesundheitlichen Beschwerden wird von der Ärztin die Fahrt in eine fachärztliche Praxis veranlaßt. Dies kann dann vorzugsweise auch der früher behandelnde Arzt sein, wenn der Häftling die konkrete Adresse angeben kann.
(305) Einmal wöchentlich kommt in der Regel ein Zahnarzt ins Haus.
(306) Es gibt im Abschiebungsgewahrsam keine Psychologen, die bei psychosomatischen Problemen der Betroffenen angemessen reagierten könnten.
(307) Im Abschiebungsgewahrsam sind neben der Ärztin und den Sanitätern auch eine Sozialarbeiterin und ein Sozialarbeiter als Ansprechpartner tätig – auch bei Nachfragen zu Problemen im Gesundheitsbereich. Ein Vertreter der Berliner Ärztekammer ist Mitglied im Beirat für den Abschiebungsgewahrsam.
(308) Für den Abschiebungsgewahrsam Kruppstraße ist eine Planstelle für Sozialarbeit vorgesehen.
4.1.2 Externe Ärzte
(309) Die Hinzuziehung eines Arztes von außerhalb des Gewahrsams durch den Häftling für Untersuchungen vor Ort ist zwar möglich, aber gemäß Gewahrsamsordnung mit bürokratischen und finanziellen Hindernissen verbunden. (Privatfinanzierung durch den Häftling, Beantragung beim und Entscheidung durch den Anstaltsleiter, Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht durch den Häftling und Präsenz eines Mitarbeiters des polizeiärztlichen Dienstes bei der Untersuchung).
(310) Im Gegensatz zu Hafteinrichtungen, in denen das Straf-vollzugsgesetz gilt, werden die Häftlinge im Polizeigewahrsam bei der Ankunft nicht routinemäßig untersucht und befragt. Ansteckende Krankheiten, vor der Haft begonnene und weiterzuführende Therapien, Indizien für eine Haftunfähigkeit müssen von den Häftlingen im Bedarfsfall selber angemeldet werden.
4.1.3 Stationäre Behandlung
(311) Krankenhauseinweisungen erfolgen in die Haftkrankenhäuser Moabit oder Plötzensee, gelegentlich auch in öffentliche Krankenhäuser.
Größere, nicht akut notwendige Maßnahmen (z. B. verschleppte Nachoperationen) werden meist während der Zeit der Abschiebungshaft nicht vorgenommen.
4.2 Beurteilung von Haftunfähigkeit, Reiseunfähigkeit, Flugunfähigkeit
(312) Haft-, Reise- und Flugunfähigkeit muß laut Gewahrsamsordnung ausschließlich von Amts- oder Polizeiärzten festgestellt und von ihnen dem LEA weitergeleitet werden, das die Haft dann aufheben muß. Ein Gutachten früher behandelnder Ärzte über eine mögliche Haftunfähigkeit kann ggf. über den Betroffenen, bzw. dessen Rechtsvertreter auch dem Amtsgericht Schöneberg vorgelegt werden, daß dann auf diesem Wege eine Haftentlassung entscheidet.
4.3 Sprachmittler
(313) Ein Problem können mangelnde Sprachkenntnisse der Abschiebungshäftlinge werden, die sich bei der Anmeldung des Arztbesuches auf der Etage, während der Untersuchung oder bei den Erklärungen über Diagnose und Therapie manchmal nur mangelhaft verständlich machen können und nicht alles verstehen, was ihnen erklärt wird. Von der offiziell vorgesehenen Möglichkeit, Sprachmittler für schwierige Situationen anzufordern, wird nicht Gebrauch gemacht. Gelegentliches Mißtrauen von Häftlingen gegenüber den angeordneten Therapien kann auch mit unvollständigem Verstehen zu tun haben.
4.4 Beirat für den Abschiebungsgewahrsam
(314) (Co-Autor: ksa) Aus dem Zwischenbericht des Beirates für den Abschiebungsgewahrsam vom 15. Oktober 1997:
Er (der Beirat) besteht, der Ausführungsvorschrift vom 21. Juni 1996 (Abl. S. 2447) entsprechend, aus fünf ehrenamtlichen, nicht weisungsgebundenen Mitgliedern. (…) Nach der Ausführungsvorschrift vom 21. Juni 1996 hat der Beirat die Aufgabe, „bei der Gestaltung des Vollzuges des Abschiebungsgewahrsams und bei der Betreuung der Abschiebungshäftlinge” mitzuwirken, „die Gewahrsamsleitung zu beraten und sich dabei für die Interessen der Abschiebungshäftlinge einzusetzen” (…)
Der Beirat hat den Eindruck, daß die Zuordnung des Abschiebungsgewahrsams zum Innenressort und insbesondere zur Polizei eine Überbetonung der Sicherheitsaspekte und eine Unterschätzung der psychosozialen Gesichtspunkte mit sich gebracht hat. Die Polizei läßt sich bei der Ausgestaltung des Abschiebungsgewahrsams ersichtlich von den Grundsätzen leiten, die für den Kurzgewahrsam gelten, mit dem die Polizei sonst befaßt ist. Bei dem herkömmlichen Polizeigewahrsam, der regelmäßig nach Stunden bemessen ist, kommt es nur auf die Sicherheit des Gewahrsams, auf die Verhinderung von Verdunkelungshandlungen und, soweit Krankheitszeichen unübersehbar sind, auf die Erste Hilfe an. Ganz andere Anforderungen stellt der Abschiebungsgewahrsam, der im günstigeren Fall eine oder zwei Wochen, nicht selten aber mehrere Monate dauert. Hier sind die psychischen Belastungen in Rechnung zu stellen, die der Freiheitsentzug mit sich bringt. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist, nicht anders als im Strafvollzug (§3 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes), entgegenzuwirken. Mag sich auch ein Teil der Abschiebungshäftlinge zuvor im Strafvollzug befunden haben, so ist doch zu berücksichtigen, daß sich im Abschiebungsgewahrsam viele Häftlinge befinden, die, abgesehen von ausländerrechtlichen Verstößen, keine Straftaten begangen, jedenfalls noch nie Haft erlebt haben. Auf sie wirkt der Aufenthalt in einer Einrichtung, die sie als Gefängnis mit hohem Sicherheitsgrad erleben, bedrückend, zumal wenn auffällige Sicherungsmaßnahmen den Eindruck vermitteln, sie und ihre Mithäftlinge würden als besonders gefährliche Personen betrachtet. (…)
Angesichts der Dauer der Abschiebungshaft und der psychischen Lage der Abschiebungshäftlinge stellen sich komplexe medizinische und psychosoziale Probleme, denen die gegenwärtigen Verhältnisse trotz guten Willens der Beteiligten nicht genügen.
- Wir erkennen gern das Engagement der Ärztin und der Sanitäterinnen und Sanitäter und die gute instrumentelle Ausstattung der Sanitätsstation an. Gleichwohl sind die gesundheitlichen Verhältnisse im Abschiebungsgewahrsam nicht befriedigend. Uns fällt auf, daß wir von den Richtern mehr Hinweise auf gesundheitliche Probleme der Häftlinge, auch auf Infektionsquellen, bekamen als von der (dort tätigen) Ärztin; wir führen das auch darauf zurück, daß den Richtern in weiterem Umfange Sprachmittler zur Verfügung stehen als der Ärztin und den Sanitätskräften. Den Gesprächen mit den Häftlingen entnehmen wir, daß gelegentlich die Weigerung von Sanitätern, eine Vorsprache bei der Ärztin herbeizuführen, beklagt wird; wir erfahren andererseits von der Ärztin, daß mehr als drei Viertel aller Häftlinge zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Sprechstunde erscheinen. Dem Antrag eines Häftlings, einen eigenen Arzt auf seine Kosten hinzuzuziehen (Nr. 2.7.5 der Gewahrsamsordnung), sollte stets stattgegeben werden. Wir halten die Regelung der Gewahrsamsordnung (aaO Abs. 2 Satz 3), daß dies nur gestattet wird, wenn der Häftling seinen Arzt von der Schweigepflicht entbindet, für unnötig und im Hinblick auf das Übermaßverbot für rechtlich bedenklich. Dem Häftling sollte in der Regel gestattet werden, allein mit seinem Arzt zu sprechen; sollten Gewalttätigkeiten gegenüber diesem Arzt befürchtet werden, so mag der Arzt über dieses Risiko unterrichtet werden.
- Nach unseren Informationen, vor allem durch die Richter, kommen Suizidversuche (Beispiel: Schlucken von Tabak durch eine Frau) vor. Die Angabe der Ärztin, daß es keine Suizide und Suizidversuche gebe, ist nach deutschen und internationalen Erfahrungen kaum plausibel, zumal da bei Abschiebungshäftlingen als Stress-faktoren nicht nur die Inhaftierung, sondern auch die Ungewißheit über die Zukunft, der Zusammenbruch der Lebensplanung und die Verständigungsschwierigkeiten eine Rolle spielen. Gesundheitlich gefährdet, vor allem im Hinblick auf Tuberkulose, scheinen besonders die Osteuropäer zu sein; diese Problematik wird auch von der Anstaltsärztin gesehen. Eine sich damit überschneidende Gruppe, die besonderer Aufmerksamkeit bedarf, sind die meist körperlich und seelisch traumatisierten Prostituierten. Auch Entzugserscheinungen Drogenabhängiger scheinen eine größere Rolle zu spielen, als wir nach anfänglichen Informationen angenommen hatten. Wir halten es für nötig, daß jeder Häftling, der neu in den Abschiebungsgewahrsam aufgenommen wird, ärztlich untersucht wird.
- Wir haben den Eindruck, daß es Defizite bei der psychosozialen Hilfe in der Krisensituation gibt, in der sich naturgemäß sehr viele Häftlinge befinden. Gewiß erlaubt die nicht sehr lange Dauer des Aufenthaltes vieler Häftlinge keine langfristig angelegten Therapien. Erforderlich ist aber vielfach eine Krisenintervention, die auch psychische Faktoren außerhalb der engeren psychiatrischen Symptomatik berücksichtigt. Wir erkennen an, daß die Ärztin – eine Internistin – bei körperlichen Beschwerden auf psychosomatische Ursachen achtet und daß auch nachts ein Sanitäter und eine Sanitäterin zur Verfügung stehen. Eine umfassende psychosoziale Beratung und Betreuung kann aber von ihr und den Sanitätskräften nicht erwartet werden. Es kommt hinzu, daß die Ärztin während der Abend- und Nachtstunden nicht in der Einrichtung ist. Kriseninterventionen, wie wir sie meinen, müssen aber kurzfristig möglich sein; das gilt zum Beispiel auch, wenn – wie kürzlich geschehen – eine Frau in erregtem Zustand nach körperlichen Auseinandersetzungen mit Grenzschutzbeamten vom Flughafen in den Abschiebungsgewahrsam zurückgebracht wird….
4.5 „Initiative gegen Abschiebehaft“
(315) (iga) In der Abschiebungshaft fehlt es an einer mäßigenden und kontrollierenden Öffentlichkeit. Immer wieder gibt es Klagen über Willkür und Schikanen. Die undurchschaubare Mischung aus korrekten und eher feindseligen Wärtern sowie die Ungewißheit über die Länge der Haft und die Folgen der Abschiebung in Länder, in denen Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und manchmal auch Krieg und Verfolgung drohen, verstärken tagtäglich Angst, Frustration und Verzweiflung der Inhaftierten. Mit diesen Ängsten werden sie sich selbst überlassen.
(316) Trotz unserer regelmäßigen Besuche bei Inhaftierten, ist unser Bild von der medizinischen Versorgung in der Abschiebehaft derzeit nur bruchstückhaft. Diese war zu Beginn unserer Arbeit vor allem durch die Nichterreichbarkeit von Ärzten gekennzeichnet. Im Köpenicker Gefängnis scheint die Ärztin leichter erreichbar zu sein. Jetzt gibt es vor allem Klagen darüber, daß man sich mit seinen Beschwerden nicht ernstgenommen fühlt.
Panik und Verärgerung rufen mitunter notwendige Zahnarztgänge hervor. Hier wirkt sich die Politik der absoluten Minimalversorgung aus, die beim einen zum Ziehen erhaltungswürdiger und beim anderen zum notdürftigen Füllen entfernungsbedürftiger Zähne führen kann und den dritten davon abhält, sich trotz schmerzender Zähne auf die Behandlung durch den Polizeiarzt einzulassen.
(317) Welche Ziele hat die Initiative gegen Abschiebehaft?
- Durch regelmäßige Besuche bei den Flüchtlingen, die das wünschen und die keine Freunde oder Verwandten in Berlin haben, wollen wir zumindest einen sozialen Minimalkontakt zur Außenwelt herstellen bzw. aufrechterhalten. Die Menschen dürfen in ihrer Verzweiflung nicht alleingelassen werden.
- Die Wärter im Polizeigewahrsam sollen merken, daß ihr Umgang mit den Inhaftierten auch von außen beobachtet und registriert wird. Schikanen und Diskriminierung, ungenügende medizinische Versorgung und ein rüder Umgangston sollen dadurch vermindert und zur Sprache gebracht werden.
- Wir versuchen zu klären, ob alle Schritte zur Vermeidung der Haft unternommen wurden. Wo möglich, werden die notwendigen Anträge gestellt, um die Haft zu beenden. Rechtliche Fragen versuchen wir mit den Inhaftierten so zu besprechen, daß die oft undurchsichtigen Zusammenhänge verständlicher werden.
Durch Öffentlichkeitsarbeit wollen wir auf eine Verbesserung der Haftbedingungen hinwirken. Dies bedeutet nicht, daß wir Haft für Ausreisepflichtige akzeptieren, denn grundsätzlich treten wir für die Abschaffung der Abschiebungshaft und einen Verzicht auf Abschiebungen ein.
5. Abschiebung
(318) (ev) Abschiebungen sind auf der Rechtsgrundlage des Ausländergesetzes geregelt. Sie soll die zwangsweise Durchführung der Ausreisepflicht gewährleisten.
„Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er eine erforderliche Aufenthaltsgenehmigung nicht oder nicht mehr besitzt”.
(319) Die Abschiebungen erfolgen in die meisten Länder auf dem Luftweg. Wird Zwischenstop eingelegt oder ist mit Widerstand zu rechnen, fliegen Polizei- oder BGS-Beamte mit. Die dabei entstehenden Kosten für die Dauer der Abschiebungshaft und die Abschiebung selber werden dem Abzuschiebenden oder seinen in Berlin/Deutschland verbleibenden Familienangehörigen auferlegt.
(320) Die Anwendung von Gewalt zum Brechen des Widerstandes bei Abzuschiebenden ist erlaubt und wird nicht selten angewendet. Selbst unter medikamentöser Ruhigstellung oder Knebelung sind schon Abschiebungen erfolgt, leider sogar mit tödlichem Ausgang.
(321) Nach der Berliner Weisungslage wurden bis 6. April 1993 generell keine Schwangeren abgeschoben. Nicht medizinischen – sondern ausländerpolitischen Erfordernissen folgend, hat die Ausländerbehörde später die Bestimmungen derart geändert, daß Schwangere nur noch Abschiebungsschutz nach Maßgabe des Mutterschutzgesetzes genießen.
Demnach dürfen Schwangere nur im Zeitraum von 6 Wochen vor bis 8 Wochen nach der Entbindung nicht abgeschoben werden. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten ist die Frist auf 12 Wochen erweitert. (43) Obwohl dieses Junktim völlig unsinnig ist, konnte die Regelung nicht verhindert werden.
(322) Wie in 3.3.1 ff. beschrieben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, daß bei Kranken Aufschub oder Aussetzung der Abschiebung erfolgt. Da das Hauptaugenmerk des Polizeiärztlichen Dienstes auf der alleinigen Beurteilung der Reisefähigkeit liegt, muß nur noch geklärt sein, ob der Abzuschiebende den Vorgang der Abschiebung bis zur Übergabe der durch ihn begleitenden BGS-Beamten am Zielort ohne Schaden zu nehmen überstehen wird. Dann werden auch schon einmal für einige Tage Medikamente mitgegeben und medizinisches Begleitpersonal als Flugbegleitung gestellt.
5.1 Letzte Interventionsmöglichkeiten bei Abschiebungen Kranker
(323) Sind juristische Wege nicht mehr offen, um die Abschiebung Kranker zu verhindern und Petitionen erfolglos – und der Vortrag im Gremium für ausländerrechtliche Härtefälle bei der Senatsinnenverwaltung fruchtlos geblieben, nimmt die verhängnisvolle Abschiebung ihren Lauf – es sei denn, neue medizinische Gesichtspunkte machen eine sofortige Krankenhausaufnahme notwendig. Für einige ist das „Kirchenasyl” der Rettungsanker, andere tauchen unter.
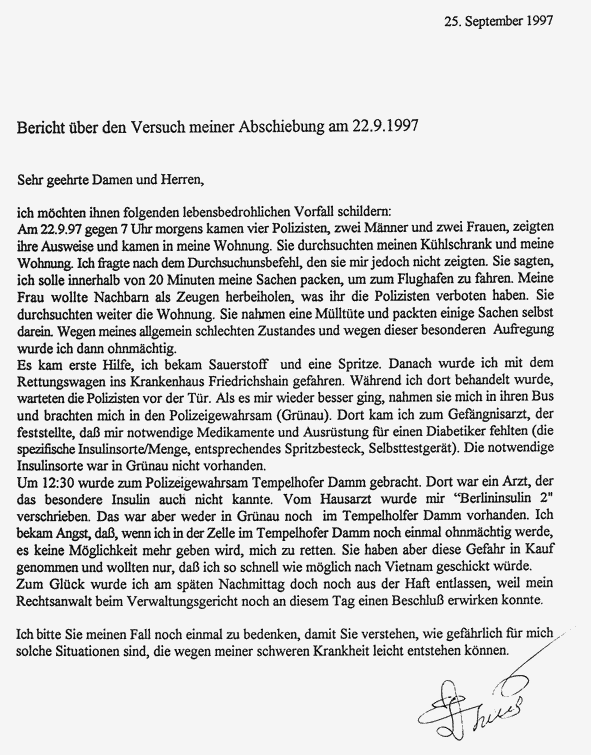
Situationsbericht eines an Diabetes erkrankten Ausländers über einen Abschiebungsversuch. Glückliche Umstände verhinderten schwerste Komplikationen.
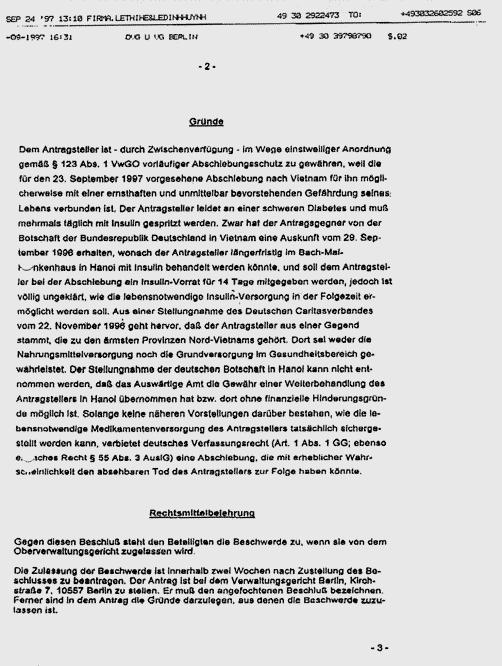
Auszug aus einer einstweiligen Anordnung eines Verwaltungsgerichts gegen die geplante Abschiebung desselben Kranken
5.1.1 Flughafensozialdienst Berlin-Schönefeld
(324) (rg) Der Flughafensozialdienst Berlin-Schönefeld (FSD) besteht seit 1990 in der Trägerschaft von Caritasverband und Diakonischem Werk. Hauptklientel waren und sind Flüchtlinge, Asylbewerber und ausländische Rückkehrer. Entsprechend der jeweiligen Problemlagen, aber auch aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten muß bei den Angeboten des FSD nach den jeweiligen Personengruppen unterschieden werden.
(325) So bietet der FSD den ankommenden Flüchtlingen und Asylbewerbern psychosoziale Beratung und Betreuung, Informationen über das Asylverfahren, Versorgung und Übernachtung, Kontaktaufnahme zu schon in Deutschland lebenden Verwandten, Vermittlung an Beratungsstellen, Rechtsanwälte, Menschenrechtsorganisationen und Seelsorger an.
(326) Freiwillig zurückkehrende Personen werden ebenfalls beraten, betreut und versorgt, soweit sie sich in den Räumen des FSD befinden.
Zu Rückkehrern, die durch die jeweilige Landespolizei direkt dem Bundesgrenzschutz übergeben werden, kann der FSD nur selten Kontakt aufnehmen. Dem BGS liegt jedoch die Bereitschaft des FSD vor, bei auftauchenden Problemen, u.a. schweren psychischen Krisen, zu helfen.
(327) Für die medizinische Versorgung aller genannten Personen ist der FSD primär nicht zuständig. Hier kann er nur Vermittlerfunktionen erfüllen, d.h., er verständigt im Notfall, soweit sich die Personen in seiner Obhut befinden, den Sanitätsdienst der Flugha-fenfeuerwehr, der sich im gleichen Gebäude befindet, bzw. den Flughafenarzt (nur Montag bis Freitag) oder einen Notarzt.
Bei Notwendigkeit wird der Betroffene in eines der naheliegenden Krankenhäuser, in der Regel KKH Neukölln oder Hedwigshöhe eingewiesen.
(328) Treten bei Rückkehrern, die sich bereits im Gewahrsam des BGS befinden, akute medizinische Probleme auf, so verständigt dieser ebenfalls den Flughafenarzt oder einen Notarzt. Diese befinden dann aus medizinischer Sicht, ob aufgrund der Erkrankung eventuell eine Fluguntauglichkeit besteht.
(329) So wurde u.a. die Abschiebung eines vietnamesischen Ehepaares gestoppt, da die Frau gerade eine Hormonbehandlung begonnen hatte, welche zu einer schweren Kreislaufbelastung führte.
(330) Immer wieder kommt es jedoch auch vor, daß Personen von ihrer Abschiebung überrascht werden. Meist haben sie dann keine Möglichkeiten mehr, sich Unterlagen über eine bestehende chronische Krankheit, die eine Fluguntauglichkeit zur Folge hätte, von ihrem behandelnen Arzt zu besorgen.
Wird in einem solchen Fall der FSD durch Bekannte, Seelsorger oder Beratungsstellen kontaktiert, so besteht die Möglichkeit einer Intervention beim BGS. Wichtig hierbei ist jedoch die korrekte Belegbarkeit der Erkrankung. Dies kann in der Regel nur durch ein vorgelegtes ärztliches Attest erfolgen, das dem FSD per FAX zur Weiterleitung an den BGS zugesandt werden sollte. Auf Grund der meist knappen Zeit ist es leider nicht möglich, daß ein Mitarbeiter des FSD dieses Attest beim behandelnen Mediziner abholt, um der ärztlichen Schweigepflicht Rechnung zu tragen. Beratungsstellen sollten daher darauf einwirken, daß medizinische Bescheinigungen jederzeit für die von einer Abschiebung bedrohten Personen erreichbar sind.
(331) Grundsätzlich bleibt zu sagen, daß eine Intervention gegen eine Abschiebung aus medizinischer Sicht möglich ist. Der BGS hat oftmals nur wenige oder gar keine Informationen darüber. So waren die Beamten beispielsweise im Falle einer bosnischen, schwangeren Frau nicht über eine von deren Ärztin attestierte Flugunfähigkeit informiert. Nach Bekanntwerden dieser Tatsache wurde die Abschiebung gestoppt.
(332) Trotz der genannten Schwierigkeiten, den sich im BGS-Gewahrsam befindlichen Rückkehrern, persönliche Hilfe zuteil werden zu lassen, erscheint es sinnvoll, den Flughafensozialdienst auch weiterhin und nicht nur bei medizinischen Problemen zu kontaktieren
Notwendig dafür sind jedoch korrekte und konkrete Informationen, die den Dienst auch rechtzeitig erreichen, da gerade bei zu verhindernen Abschiebungen nur wenig Zeit zur Verfügung steht.
5.1.2 Flughafenarzt
(333) (ev) Die Möglichkeit besteht also, den Flughafensozialdienst direkt immer dann um Mithilfe zu bitten, falls medizinische Gründe gegen eine Abschiebung sprechen.
(334) Diese Informationen könnten auch direkt an den im Flughafengelände praktizierendem Arzt herangetragen werden. Dies sollte zu einem möglichst frühem Zeitpunkt vor der Abschiebung geschehen.
Durch diesen direkten Weg kann die wenige noch verbleibende Zeit optimaler genutzt werden und die ad hoc beigebrachten Atteste oder Aussagen vorbehandelnder Ärzte unmittelbarer und mit dem zusätzlichen Sachverstand des Flughafenarztes versehen, zu einer möglichen Revision der Entscheidung der BGS-Leitung führen.
(335) Der im Flughafen tätige Arzt könnte sogar zu dem Kranken vorgelassen werden, um sich einen unmittelbaren Eindruck seiner gesundheitlichen Verfassung und vor allem seiner Reisefähigkeit zu verschaffen. Da er auch über eine fliegerärztliche Zusatzausbildung verfügt, kann er natürlich auch kompetent die Flugfähigkeit beurteilen und auf die Revision eines zuvor ausgestellten Attestes dringen. Selbst wenn durch polizeiärztliche Untersuchungen zuvor eine Reise- bzw. Flugfähigkeit festgestellt wurde, kann sich dieser Zustand innerhalb kurzer Zeit ins Gegenteil verkehren, ohne daß dann noch Einflußmöglichkeiten ärztlicherseits bestünden. Hier kann der Flughafenarzt noch in „letzter Instanz“ vor der Abschiebung eingreifen – ebenso auch dann, wenn Informationen über einen angedrohten Suizid vorliegen oder Hinweise auf Medikamentengabe zum Zweck einer leichteren Abschiebung durch „Ruhigstellung“.
6. Gremium für ausländerrechtlinche Härtefälle („Härtefallkommission“)
(336) (tv) (…) „Jedes noch so ausgefeiltes Gesetz und jede noch so gründlich durchdachte Regierungsverordnung zeigt manchmal in der Praxis Mängel. Selbst eine sorgfältig überlegte Entscheidung, auch die bestgemeinte Beratung in der Behörde, kann fehlerhaft sein, ganz zu schweigen davon, daß jeder bürokratische Apparat dazu neigt, Sonderfälle als belastend anzusehen. Unrecht und Ungerechtigkeit sind nicht selten die Folge” (…) (44)
(337) Ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen, die geltend machen, daß von der Abschiebung abgesehen werden soll, weil ihnen erhebliche Gefahren für Leib und Leben drohen, können sich in einigen Bundesländern an Härtefallkommissionen wenden – so in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.
(338) Die Härtefallkommissionen sind behördenunabhängige Beratungsgremien, die sich aus Mitgliedern von Kirchen, Flüchtlingsorganisationen, Sozialverbänden, den Ministerien bzw. Senatsverwaltungen für Gesundheit und Soziales zusammensetzen und den Innenministerien bzw. dem Innensenat zugeordnet sind.
(339) Diese Kommissionen können lediglich Empfehlungen an die Ausländerbehörden geben, wenn in der Ausreise eine besondere Härte zu sehen ist. Es wird folglich kein neuer Rechtsweg – der eine Abschiebung aussetzen oder verhindern könnte – eröffnet, vielmehr werden die Ausländerbehörden bei deren Ermessensausübung zu Gunsten eines Antragstellers beraten.
(340) Ein erheblicher Anteil der an das Berliner Gremium gerichteten Anträge betrifft medizinische Probleme. Hierzu gehören schwerwiegende Gesundheitsgefahren, denen kranke Ausländer wegen des unzureichenden Gesundheitssystems in ihrem Heimatstaat ausgesetzt wären, würde man sie abschieben – zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse, und solche, die der Durchführung der Abschiebung als solcher entgegenstehen – inlandsbezogene Vollstreckungshindernisse.
(341) Je nach Lage des Falles, korrekter: Schwere und Prognose der Krankheit, kann die Ausländerbehörde eine zeitlich befristete Aussetzung der Abschiebung (Duldung) oder einen längerfristigen Aufenthaltstitel (Befugnis) aus „dringenden humanitären Gründen” erteilen.
(342) Während nun die inlandsbezogenenen gesundheitsbedingten Vollstreckungshindernisse relativ leicht nachvollziehbar darzustellen sind – von der akuten, fieberhaften Erkrankung über die begonnene stationäre Therapie bis zur in Kürze bevorstehenden Entbindung – ist dies bei zielstaatsbezogenen gesundheitsbedingten Abschiebungshindernissen ungleich schwerer.
Vor allem deshalb, weil für die meisten Ausländerbehörden ausschließlich die ärztlich (amtsärztlich, polizeiärztlich) bescheinigte „Reiseunfähigkeit/Flugunfähigkeit” den Ausschlag für den Verzicht auf die sofortige Durchführung der Abschiebung gibt.
(343) In diesem Zusammenhang muß noch einmal darauf hingewiesen werden, daß bei der Frage nach der Reisefähigkeit ausreisepflichtiger Ausländer lediglich beurteilt werden muß, ob die Person X den Transport von A nach B ohne gravierende, gesundheitliche Schäden übersteht.
6.1 Ungewöhnliche Einblicke
Beispiele inlandsbezogener Vollstreckungshindernisse:
(344) In den meisten Bundesländern werden Schwangere, nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und dem Mutterpaß, ab 6 Wochen vor der Entbindung nicht mehr abgeschoben. Das gleiche gilt für die ersten 8 Wochen nach der Entbindung (resp. 12 Wochen nach Mehrlings- oder Frühgeburten). Eventuell ausschlaggebend für diese Entscheidung war, daß innerhalb dieses Zeitraumes für Mutter und/oder Kind schwerere gesundheitliche Gefährdungen nicht auszuschließen sind und daß Fluggesellschaften Hochschwangere nicht mehr transportieren.
(345) Frau A. aus Ghana liegt mit kompliziertem Beckenbruch im Krankenhaus. Die Abschiebung muß ausgesetzt werden, bis die Knochenbrüche geheilt sind. Sie kann jedoch solange ausgesetzt werden, bis die Mindestrehabilitationsmaßnahmen abgeschlossen sind.
(346) Kind Z. aus Libanon leidet an einer akuten hochfieberhaften Mittelohrentzündung. Die Ausländerbehörde erlaubt dem Kind mit seiner Mutter bis zur Heilung in Berlin zu bleiben, da die Fluggesellschaft sich weigert, das Kind wegen des mangelnden Druckausgleiches zu transportieren. Dadurch könnten irreparable gesundheitiche Schäden auftreten. Der Sofortabschiebung des Vaters und der anderen 5 minderjährigen Geschwistern des Kindes steht jedoch nichts im Wege.
(346) Hier könnte zur Vermeidung einer besonderen Härte – der Vater kann nicht alleine die fünf Kinder versorgen und betreuen – oder aus Gründen der Kostenersparnis – die gemeinsame Abschiebung aller acht Personen ist „billiger” zu haben als Einzeltransporte – eine gemeinsame Reise ermöglicht werden.
In diesen und in ähnlich gelagerten Fällen ist also eine Ausreisefristverlängerung nach Vorlage detaillierter ärztlicher Atteste und der Schweigepflichtentbindung relativ problemarm zu erreichen.
Beispiele zielstaatsbezogener Abschiebungshindernisse:
(347) Frau M. aus einem afrikanischen Land wird bei einer Razzia aufgegriffen und kommt wegen illegalen Aufenthalts in Abschiebungshaft.
Hier erklärt sie der zuständigen Polizeiärztin und dem Haftrichter, sie sei an AIDS erkrankt. Sie stehe häufig in stationärer und ständig in ambulanter Behandlung. Auch die entsprechenden Anschriften von Arzt und Klinik kann sie angeben. Nachdem diese die Erkrankung bestätigten und in mehreren Schreiben eindrucksvoll darauf hinwiesen, daß der Abbruch der Therapie zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen und die, ohnehin eingeschränkte, Lebenserwartung drastisch verkürzen werde, bescheinigt die Polizeiärztin dessen ungeachtet: „Reise- und Haftfähigkeit liegen ohne Frage vor”.
Nach den engen Kriterien trifft dies wohl auch zu, denn den Flug nach Kenia werde sie ohne Schaden überstehen. Obgleich der Abschiebungsflug von der Ausländerbehörde schon gebucht ist, wird wegen des schlechten Gesundheitszustandes Haftbeschwerde eingereicht, die Senatsverwaltung für Inneres als Fachaufsicht der Ausländerbehörde eingeschaltet und ein Antrag bei der Härtefallkomission gestellt. Gleichzeitig bittet man außer AIDS-Hilfe auch medico international, Caritas international, den Deutschen Entwicklungsdienst und den in diesem Land arbeitenden missionsärztlichen Dienst um Auskünfte zu Behandlungsmöglichkeiten vor Ort. Auch muß eine Unterkunft gesucht werden, damit die polizeiliche Anmeldung – als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Hafttentlassung – erfolgen kann.
Nach Eingang und Vorlage der Antworten, die einstimmig bestätigten, daß im Herkunftsland eine Fortführung der lebenserhaltenden Therapie ausgeschlossen ist, teilt die Senatsverwaltung für Inneres mit:
„Wir haben die Ausländerbehörde gebeten, Frau M. eine Duldung nach §55, 2 AuslG zu erteilen. Eine Ausreise ist wegen des schlechten Gesundheitszustandes und der in NN zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten nicht möglich.”
Frau M. wird sofort aus der Abschiebungshaft entlassen.
(348) Der 4-jährige T. aus Mostar wird mit seinen Eltern bei Abschiebeandrohung zur Ausreise aufgefordert. T. leidet jedoch an einer besonders schweren Form der Mukoviszidose, die in Bosnien nicht behandelt werden kann. Niedergelassene Kinderärzte und die Mukoviszidose Abteilung eines Berliner Krankenhaus bescheinigen, der Abbruch der Therapie werde das „sichere Todesurteil” für das Kind bedeuten. Bei Fortführung der Behandlung bestehe jedoch „eine annähernd normale Lebensqualität und Lebenserwartung”.
Die Ausländerbehörde dagegen besteht weiterhin auf Ausreise unter Berufung auf einen Bericht des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik der feststellt, daß das „Gesundheitswesen in Bosnien derart stabilisiert sei, daß die Fortführung der Behandlung in Bosnien gewährleistet scheint”.
Sowohl die daraufhin angefragte Deutsche Mukoviszidosehilfe unter dem Vorsitz der Frau des Bundespräsidenten, Christiane Herzog, als auch die kontaktierte Kinderklinik in Mostar und regierungsunabhängige Hilfsorganisationen bestätigten diametral entgegengesetzt zum Auswärtigen Amt, daß eine Dauerbehandlung des Kindes in Bosnien nicht möglich ist: „An dieser Krankheit leidende Kinder müssen wir zur Behandlung ins Ausland schicken”.
(349) Neben diesen relativ klar zu unterscheidenden Abschiebungshindernissen gibt es eine Vielzahl von Mischformen. Auch hier ist zur Lösung der Probleme ärztliches Wissen und Engagement gefragt.
Dies bezieht sich auch auf die Bereitschaft zur interdisziplinären Arbeit – auch trotz häufig fehlender Kostenerstattung.
(350) Typische und leider sehr häufig vorzutragende humanitäre Härtefälle, die sich auf medizinische Abschiebungshindernisse gründen, sind sehr alte- oder geistig- oder körperlich behinderte Menschen, die in Berlin in ihren bleibeberechtigten Familien gut versorgt sind, im Abschiebungsland aber oft nur unzureichend oder garnicht betreut werden können. Gleiches gilt für psychisch Kranke, für Traumatisierte und Drogenabhängige in der Substitutionstherapie.
(351) Immer geht es darum, in ausführlichen Attesten die Gesundheitsgefährdung durch die Abschiebung als solche, aber vor allem durch die Verhältnisse im Zielland – auch für Verwaltungsbeamte nachvollziehbar! – nachzuweisen und gegebenenfalls auch zu belegen.
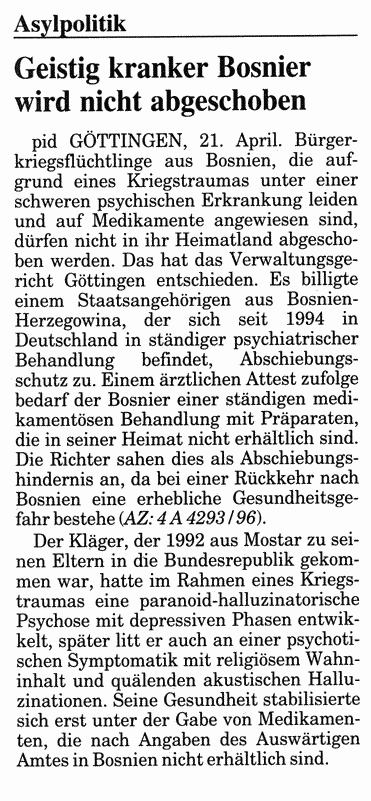
Zeitungsnotiz über zugebilligtem Abschiebungsschutz wegen fehlender medizinischer Behandlungsmöglichkeit im Zielland.
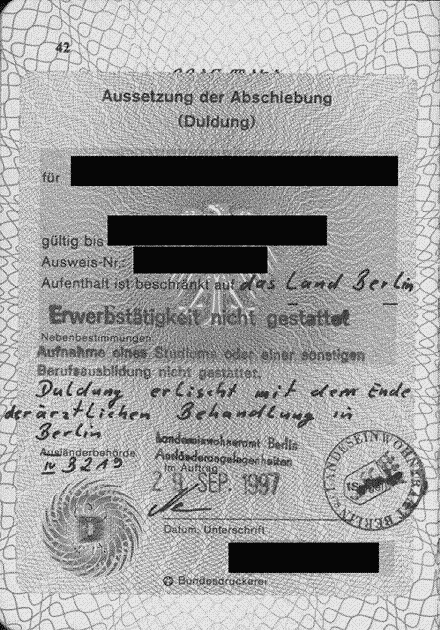
Nationalpaß mit handschriftlich von der Berliner Ausländerbehörde eingetragenem Vermerk der Duldung mit zeitlicher Begrenzung bis zum Ende der ärztlichen Behandlung.
7. Thesen
- Mit der Herausnahme einer großen Zahl Leistungsberechtigter aus dem Bereich des Bundessozialhilfegesetzes und der Schaffung eines neuen „schlanken” Gesetzeswerkes – Asylbewerberleistungsgesetzes – wurde erstmals ein Eckstein des Sozialstaatsprinzips in der Bundesrepublik Deutschland aufgegeben. Dieser Vorgang hat Modellcharakter und kann sich zu späterem Zeitpunkt auch für andere, sozial-definierte, Gruppen wiederholen.
- Nach der Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes (1.6.1997) reduziert sich die Möglichkeit erstattungsfähiger medizinischer Hilfe endgültig auf ein drittklassiges Niveau.
Erhält nun der am 6.2.1998 im Bundesrat schon beschlossene Gesetzentwurf zur nochmaligen Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes nach entsprechendem Abstimmungsergebnis im Bundestag Gesetzeskraft, wird es noch 1998 für eine Vielzahl von Menschen zu einem völligen Ausschluß des Anspruchs auf Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz kommen – so für alle bosnischen Kriegsflüchtlinge, für Flüchtlinge aus dem Kosovo, aus Afghanistan, aus dem Libanon und aus etlichen afrikanischen Ländern. Zirka 250.000 geduldete ausreisepflichtige Flüchtlinge erhalten somit auch keine medizinische Versorgung mehr.
- Restriktives Verwaltungshandeln und angeblich fehlende finanzielle Resourcen blockieren zusätzlich die verbleibenden Möglichkeiten effektiver Diagnostik und Therapie. Hier sind die Prioritäten aus politischen Gründen falsch gesetzt.
- Grundwerte des Persönlichkeitsschutzes werden bei Asylsuchenden, Flüchtlingen und Ausländern mit und ohne Aufenthaltsrecht sukzessive aufgehoben. Das betrifft u.a. Datenschutz, medizinische Schweigepflicht und freie Arztwahl.
- In Praxis und Klinik nehmen die Defizite an Zuwendung, Aufklärung und Sprachmittlung gegenüber diesen Patienten zu. Gleichgültigkeit und vordergründige Ablehnung dieses Personenkreises sind Wurzeln diesesr Entwicklung.
- Es ist skandalös und widerspricht den Geboten der Menschlichkeit, daß die in Berlin lebenden geschätzten 100.000 Ausländer ohne Aufenthaltsrecht von der medizinischen Regelversorgung völlig ausgenommen sind. Der Berliner Senat und seine Ausländerbeauftragte erachten es bis jetzt nicht für notwendig, Leistungskonzepte für eine effiziente medizinische Versorgung dieses Personenkreises zu entwickeln. Sie spekulieren im Gegenteil darauf, daß freie Initiativen mit unterschiedlichen Motivationen und auf eigene Kosten versuchen, diese Probleme in Einzelfällen zu entschärfen.
- Bei gebotenem medizinischem Handeln nehmen Eingriffe und Mißtrauen gegenüber dem medizinischen Personal auf den Ebenen Senat-Ausländerbehörde-Polizeiärztlicher Dienst in erschreckendem Maße zu.
Aber auch Mitarbeiter von Kliniken mißtrauen kranken Ausländern ohne Aufenthaltsrecht und denunzieren sie sogar der Polizei ohne dazu gesetzlich gezwungen zu sein.
- Die Häufung von Fällen, in denen aus ärztlicher Behandlung heraus Abschiebungen erfolgen, ist gravierend. Dabei spielt die Beurteilung durch den Polizeiärztlichen Dienst, ob im Herkunftsland die notwendige Weiterbehandlung fortgeführt werden kann, gegenüber der Frage, ob der Patient reisefähig ist, gar keine oder höchstens eine untergeordnete Rolle.
- Die medizinische, vor allem aber die psychotherapeutische Betreuung im Abschiebungsgewahrsam ist defizitär.
Die diskriminierende Inhaftierung von Ausländern ausschließlich zum Zweck der Abschiebung ist für sich allein schon Ursache von Krankheiten, psychischer Krisensituationen und Suizidversuchen.
- Ärzte nehmen ihre – aus berufsethischer Sicht und rechtsstaatlicher Verfaßtheit unseres Staates abgeleiteten – Zuwendung gegenüber schutzbedürftigen ausländischen Patienten nicht mehr in ausreichendem Maße wahr.
Ärztliche Standesvertreter unterschätzen ihre Einflußmöglichkeiten auf Staat und Gesellschaft, diese Entwicklung zu entschärfen.
8. Ausblicke
(353) Die multiethnische Bevölkerung Berlins wird zunehmend weniger als Bereicherung begriffen, eher als Herausforderung mit Bedrohungscharakter – in besonderem Maße für Senatsverwaltungen, Polizei und Ausländerbehörde.
(354) Im Gegensatz zur deutschen Bevölkerung wird auf die Belange der Nichtdeutschen mit einer Vielzahl spezieller Gesetze, Verordnungen und Weisungen reagiert. Sie haben regulierenden und einengenden Charakter. Einige tangieren die Menschenwürde und sind massive Eingriffe in die Lebensqualität.
(355) Das betrifft auch in erschreckendem Maße medizinische Belange. Die Einengung medizinischen Handelns ist für die Agierenden jedoch noch immer nur bruchstückhaft wahrnehmbar. Welche Wirkungen sie auf Betroffene haben, entzieht sich fast immer ihrer Kenntnis.
(356) Wenn sich die im Medizinbereich tätigen Menschen nicht dieser Tendenz entgegenstellen, wer sollte es mit dem Wissen aller daraus erwachsenden Folgen sonst tun?
(357) So wächst dann auch zunehmend der Wille von Ärzten, ihre Berufswissen nicht mehr den administrativen Belangen des Staates zur Verfügung zu stellen, wenn sie ärztlichen Grundsätzen und ihrer Berufsordnung entgegenstehen.
Dadurch leisten sie einen Beitrag gegen die beklagenswerten Willfährigkeit in unserem Staat.
(358) Ausdruck dessen, wie ärztliches Wissen und Handeln in staatlichem Auftrag genutzt wird, sind Bestrebungen,
- minderjährige Flüchtlingskinder durch Handwurzelröntgenuntersuchungen einer älteren Altersgruppe zuzuordnen,
- durch Genanalysen, die in der Kriminologie ihre Berechtigung haben (sog. genetischer Abdruck-Speicheltest-DNA-Analyse) Verwandschaftsverhältnisse zwischen asylberechtigten Eltern mit ihren noch im Ausland lebenden Kindern zu beweisen, obwohl diese schon zuvor ein verbrieftes Recht auf Familienzusammenführung hatten,
- wider besseren Wissens Kranke von Polizeiärzten reisefähig und damit zur Abschiebung „freizugegeben”, obwohl nach medizinischer Kenntnis dadurch später schwere Schäden, vielleicht sogar der Tod, zu erwarten sind,
- Abschiebungen manchmal nur noch mit ärztlicher Hilfe durchführen zu können, selbst wenn die Gefahr besteht, daß der Abzuschiebende dadurch zu Tode kommt.
Begreifen sich Ärzte und im Gesundheitswesen Tätige mehr als bisher – selbst gegen äußere Widerstände – als Fürsprecher ihrer Patienten, auch als politisch Handelnde im Wissen um das Angepaßtsein ihrer Berufskollegen im Dritten Reich, wird dies unserem demokratischen Staatswesen und den darin lebenden deutschen wie ausländischen Menschen gut zu Gesicht stehen.
Sie befinden sich dann in guter Gesellschaft mit den Vielen, die sich den brutalen ausländerfeindlichen Handlungen entgegenstellen – aber auch den subtileren Methoden von Legislative und Exekutive, wenn diese sich vom Gebot der Humanität und Gerechtigkeit entfernen.
Neben den geschilderten vielfältigen Möglichkeiten persönlichen Engagements soll noch über ein Vorhaben berichtet werden, das für die medizinische Versorgung von Migranten große Bedeutung haben könnte.
9. Interkulturelles Gesundheitszentrum für Berlin
(359) (ipw) Seit geraumer Zeit schon suchen Politiker und Fachleute nach Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung bzw. verbesserten Gesundheitsversorgung von Migrantinnen und Migranten in Berlin. Die Literatur zum Themenbereich „Migration und Gesundheit” weist zum einen auf erhebliche Defizite in der gesundheitlichen Versorgung hin zum anderen auf ein höheres Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko bei Migranten wie eine höhere Rate von Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit, von Infektionskrankheiten,von Erkrankungen des Magen-Darm-Bereichs, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, von Arbeitsunfällen, von frühzeitig auftretenden chronischen Krankheiten im Alter, von Unfällen (Haus und Verkehr), von psychischen und psychosomatischen Störungen bei Kindern, von Multimorbidität (Schmerzen) bei Frauen.
Die vorliegenden Untersuchungen beziehen sich vor allem auf Arbeitsmigranten, einige auf Flüchtlinge und Aussiedler, ganz wenige auf Ausländer ohne Aufenthaltsrecht.
(360) Angesichts der hohen Zahl von Migranten in Kreuzberg und auch in den übrigen Bezirken ist das Bezirksamt Kreuzberg unter Federführung der Plan- und Leitstelle und der Ausländerbeauftragten einer langjährigen politischen Forderung zum Aufbau eines „Interkulturellen Gesundheitszentrums” gefolgt. Beispiele aus anderen Städten wie das „Ethnomedizinische Zentrum” in Hannover dienten als Vorbild.
(361) Die seit Ende 1996 arbeitende ehrenamtliche Planungsgruppe, bestehend aus Vertretern von Wohlfahrtsverbänden, freier Träger, des öffentlichen Gesundheitsdienstes, des Krankenhausbereiches und der Wissenschaft, war sich der vielfältigen Interessen der seit den 70er/80er Jahren bestehenden Struktur von Selbsthilfegruppen, Initiativen von Wohlfahrtsverbänden, staatlichen Institutionen und freien Trägern auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und -versorgung von Migrantinnen und Migranten bewußt, ebenso wie der Ängste und Vorbehalte, daß im Rahmen der Sparmaßnahmen zugunsten eines neuen Zentrums bestehende Einrichtungen und Stellen wegrationalisiert werden könnten.
(362) Um in diesem Spannungsfeld ein breites von vielen Initiativen und Einrichtungen getragenes Bedarfs- und Meinungsbild erstellen zu können, wurde eine Planungsstrategie mit partizipativer Vorgehensweise gewählt, die versuchte, alle wichtigen Akteure und Betroffenen mit einzubeziehen, auf Konsens orientiert war und größtmögliche Transparenz von Prozessen und Entscheidungen zum Ziel hatte.
(363) Von der Planungsgruppe wurde unter Einbeziehung von Betroffenen, Wissenschaftlern und Experten eine
- Problemanalyse zur gesundheitlichen und psychosozialen Situation von Migranten, eine
- Beteiligtenanalyse der Hauptakteure und Kooperationspartner und
- Zielvorschläge und Aufgaben eines Interkulturellen Gesundheitszentrums
erarbeitet.
(364) Ziel des geplanten Interkulturellen Gesundheitszentrums ist es, auf eine Verbesserung und Chancengleichheit in der gesundheitlichen und psychosozialen Situation von Migrantinnen und Migranten unter Berücksichtigung aller Nationalitäten hinzuwirken.
(365) Es soll ein Netzwerk entstehen, das beratende, vermittelnde und koordinierende Aufgaben wahrnimmt. Durch die Einrichtung einer berlinweiten Datei sollen die Information über die vielfältigen Angebote und Anbieter für Migranten und Professionelle nutzbar gemacht werden.
(366) Zur Unterstützung von Patienten und Fachpersonal in der medizinischen und psychosozialen Versorgung ist der Aufbau eines Dolmetscher- und Sprachmittler-Services geplant, Fort- und Weiterbildungsangebote zur interkulturellen und sprachlichen Kompetenzerweiterung für Fachpersonal im Gesundheits- und Sozialwesen sollen koordiniert und initiiert werden.
(367) Eine Vernetzung von Fachkräften und Diensten im Gesundheits- und Sozialbereich durch Austausch und gemeinsame Projektarbeit ist geplant, um Defizite besser zu erkennen und entsprechende Hilfsmöglichkeiten zu entwickeln, Ressourcen zu bündeln und gezielter einzusetzen, Qualität in der Versorgung von Migranten zu optimieren sowie Austausch und Unterstützung zu gewährleisten hinsichtlich der interkulturellen Öffnung sozialer und gesundheitlicher Dienste.
(368) Über die mögliche Trägerschaft und die Finanzierung des Projektes wird noch beraten. Erste Schritte zum Aufbau erfolgen z. Zt. durch die Plan- und Leitstelle Kreuzberg mit Hilfe externer Personalressourcen.
(369) Die Initiative hat in der Fachöffentlichkeit und bei verschiedenen politischen Parteien große Resonanz und Unterstützung gefunden. Die breitgetragene Forderung nach Koordinierung und Vernetzung von bestehenden Einrichtungen, Vermittlung von Sprachkompetenzen, interkultureller Öffnung und Organisationsentwicklung findet leider bisher bei den politischen Entscheidungsträgern der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales keine Unterstützung, obwohl die Koordination und Vernetzung in der Gesundheitsversorgung als wesentliche Aufgabe für den öffentlichen Gesundheitsdienst gesetzlich fixiert ist.
10. Textnachweise
Berufsordnung der Ärztekammer Berlin
(vom 24. Januar 1996)
Bezug: Ärztekammer Berlin
Flottenstr. 28-42, 13407 Berlin
Deutsches Ausländerrecht
Ausländergesetz
Asylverfahrensgesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Sozialrechtliche Vorschriften (Auszüge)
Genfer Flüchtlingskonvention
u.a.
Beck-Texte im dtv 5537. AusländerR. 12. Auflage 1998
Erstes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetz
vom 26. Mai 1997
Bundesgesetzblatt Jahrgang 1997 Teil I Nr. 32
Zwischenbericht des Beirates für den Abschiebungsgewahrsam
vom 15. Oktober 1997
Bezug: Ärztekammer Berlin
Flottenstr. 28-4, 13407 Berlin
Menschenwürde mit Rabatt
Das Asylbewerberleistungsgesetz und was man dagegen tun kann
Bearbeitet von Georg Classen – Hrsg. von PRO ASYL,
Förderverein Pro Asyl e.V.
Gesetzestexte, Durchführungsverordnungen, kommentierte Gerichtsentscheidungen, Handlungshilfen, Dokumentationsteil
Bezug: PRO ASYL
Postfach 10 18 43, 60018 Frankfurt/M
11. Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
pvb Petra von Bültzingslöwen, Krankenschwester im Arztmobil
Caritasverband für Berlin e.V.
sg Dr. med. Sepp Graessner, Arzt
Mitarbeiter im Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin
lg Dr. med. Lothar Grunau, Arzt
Mitglied im Beirat für die Berliner Justizvollzugsanstalten
bg Pater Bernd Günther SJ, Katholischer Priester
Seelsorger im Abschiebegewahrsam Berlin-Grünau
Internationaler Jesuiten – Flüchtlingsdienst (JRS)
rg Roland Guske, Sozialarbeiter beim Flughafensozialdienst Berlin-Schönefeld
eh Dr. med. Ellis Huber, Arzt
Präsident der Ärztekammer Berlin
iga Mitarbeiter in der Initiative gegen Abschiebehaft
ck Claudia Kruse, Sozialarbeiterin
Mitarbeiterin im Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin
mf Mitarbeiter im Büro für Medizinische Flüchtlingshilfe
um Dr. phil Ulrich Mehlem, Islamwissenschaftler
Arbeitskreis Medizin und Soziales im Flüchtlingsrat Berlin
fm Frank Merkord, Sozialarbeiter
Mitarbeiter im Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin
ipw Ingrid Papies-Winkler, Sozialpädogogin, Diplom Politologin
Mitarbeiterin in der Plan- und Leitstelle Gesundheitsförderung, Bezirksamt Kreuzberg von Berlin, Abteilung Soziales und Gesundheit
up Ulla Peitz, Ärztin
Beauftragte für Menschenrechte der Ärztekammer Berlin
ksa Dr. med. Kurt Samuel, Arzt
Vorstandsmitglied der Ärztekammer Berlin
Mitglied im Beirat für den Abschiebegewahrsam Berlin-Köpenick
ks Prof. Dr. med. Klaus Schäfer, Arzt
Ärztlicher Direktor St.Joseph-Krankenhaus
Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen
tv Traudl Vorbrodt, Kinderkrankenschwester
Mitglied im Gremium für ausländerrechtliche Härtefälle des Senates von Berlin (Härtefallkommission)
pax christi Berlin – Härtefallberatung
ev Eberhard Vorbrodt
, Arzt
Sprecher des Arbeitskreises Medizin und Soziales des Flüchtlingsrates Berlin
12. Adressen
Flüchtlingsrat Berlin
Fennstraße 31, 12439 Berlin
Tel. (030) 631 78 73, Fax (030) 636 11 98
Ärztekammer Berlin
Flottenstr. 28-42, 13407 Berlin
Tel. (030) 40 80 60, Fax (030) 40 80 6-126
Pro Asyl
Förderverein Pro Asyl e.V.
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge
Postfach 16 06 24, Frankfurt/Main
Tel. (069) 23 06 88, Fax (069) 23 06 50
In Kooperation mit der Stiftung Umverteilen.
Impressum:
Konzept
und Redaktion: Eberhard Vorbrodt
Dr. phil. Ulrich Mehlem
Satz/Gestaltung: Florian Vorbrodt
Druck: agit-druck
1. Auflage: 1.200
Bezug: Flüchtlingsrat Berlin
Im Flüchtlingsrat Berlin arbeiten seit 1981 Initiativen, Organisationen, Beratungsstellen und Flüchtlingshilfegruppen zusammen, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten sowie die Wahrung ihrer Menschenwürde und Rechte einsetzen und sie verteidigen. Er vertritt die Berliner Flüchtlingsarbeit nach außen und ist Ansprechpartner für die Öffentlichkeit und Medien. Als Anerkennung für diese Arbeit wurde dem Flüchtlingsrat Berlin im Jahr 1989 der „Gustav W. Heinemann-Bürgerpreis” verliehen.