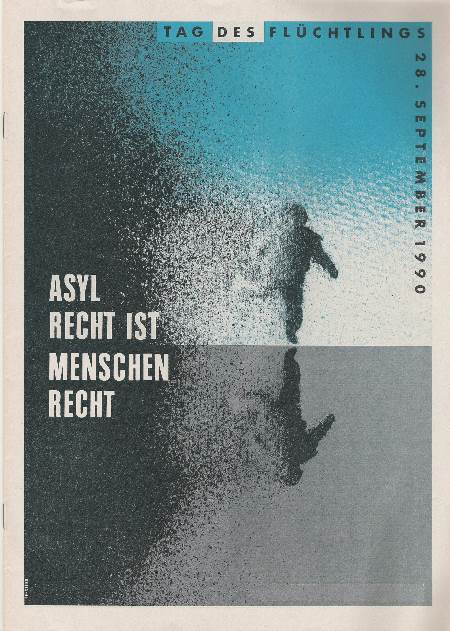TAG DES FLÜCHTLINGS 1990
Europäische Asylpolitik
Walter Schmid
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (1990)
- Grußwort der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (1990)
ANALYSEN
- Der gläserne Flüchtling – Gespräch mit Prof. Dr. Spiros Simitis
- Europäische Asylpolitik
- Was garantiert das Grundgesetz? – Zur Diskussion über Asylsuchende und Aussieder
- Behebung der Fluchtursachen
- Flüchtlinge im „Karlsruher Loch“
- Schnellverfahren an der Grenze
FLÜCHTLINGSSCHICKSALE
- Rückblick auf ein Jahrzehnt der Flucht
- „Ich fühle mich wie ein Mann, der mit seinen zwei Beinen in zwei verschiedenen Booten steht“
- „Alles wegen eines Weihnachtsbaumes“
BEISPIELE UND ANREGUNGEN
- Grundregeln der Pressearbeit
- Begrüßungsgeld für Flüchtlinge
- Aufnehmen oder Ausliefern? -Text für eine Meditation
- „Wir suchen Asyl in Ihrer Kirche“
- Aussiedler, Übersiedler, Flüchtlinge: die gleiche Betroffenheit
- Asylantrag als Eintrittskarte
- Umfrage in der Fußgängerzone
- „Bettelmarsch“ gegen drohende Abschiebung
STATISTIK
Die Harmonisierung des europäischen Asylrechts ist hier das Thema – dieser unaufhaltsame europäische Integrationsprozess voll Chancen und Gefahren, dem sich kein Land wird entziehen können. Chancen sind mit diesem Integrationsprozess zweifellos verbunden, wenn wir uns daran erinnern, welch unermeßliches Leid die zahllosen Kriege unter europäischen Nationen den Menschen dieses Kontinents gebracht haben. Neben der wirtschaftlichen Stärkung wird die friedenserhaltende Funktion wohl die größte Leistung des Integrationsprozesses sein. Gefahren? Den wirtschaftlichen Interessen, die vom Anstoß zur damaligen EWG bis zum Abschluß des europäischen Binnenmarktes der eigentliche Motor der europäischen Integration waren, könnte vielleicht zuviel geopfert werden. Zuviel an Vielfalt, zuviel an Werten und Traditionen, zuviel an regionaler Autonomie und unterschiedlichen Strömungen, die diesen Kontinent so reich gemacht haben. Noch ist Europa ein Kontinent der Vielfalt.
Rechtsgrundlagen der Asylverfahren
Zunächst eine ganz einfache Feststellung: Alle Staaten Westeuropas haben die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 unterzeichnet. Alle westeuropäischen Staaten haben überdies auch das Protokoll von 1967 unterzeichnet, mit dem die zeitliche und die geographische Beschränkung der Konvention aufgehoben wurde. Mit einer gewichtigen Ausnahme allerdings: Italien (und auch Malta) hielten den geographischen Vorbehalt aufrecht und erkennen bis heute Personen, die von außerhalb Europas herkommen, nicht als Flüchtlinge an. Als erstes Land Osteuropas dagegen hat Ungarn die Genfer Konvention unterzeichnet. Dies darf als bedeutsames Zeichen für die Bewegung in der politischen Szenerie Europas gewertet werden.
Alle Länder haben ein nationales Gesetz (wenigstens im materiellen Sinn) über das Asyl- oder Fremdenrecht erlassen. Damit wurden die Grundsätze der Genfer Konvention ins nationale Recht umgesetzt. Faszinierend ist es zu sehen, auf wie verschiedene Weise die Staaten eine einheitlich abgefaßte Konvention in ihr nationales Recht übertragen haben.
Einreisebestimmungen
Jedes Land kennt nationale Einreisebestimmungen, die der Begrenzung und Kontrolle der Einreise dienen. Diese Einreisebestimmungen, von denen noch verschiedentlich die Rede sein wird, sind für die einzelnen Länder von unterschiedlicher Bedeutung. Es gibt Länder, die ihre Asylpolitik vor allem über die Einreisebestimmungen gestalten (Großbritannien, Dänemark). Es sind dies Länder, die ihrer geographischen Lage wegen Einreisebeschränkungen wirksam
durchsetzen können. Andere Länder – wie die Schweiz oder die Niederlande – haben kaum die Möglichkeit, Einreisebestimmungen wirksam durchzusetzen. Wieder andere Länder sind in eine Paßunion mit Nachbarstaaten eingebunden. Ihre Möglichkeiten zu Grenzkontrollen sind von diesen Verträgen her begrenzt (vgl. nordische Paßunion). Wenn heute über Harmonisierung des Asylrechts gesprochen wird, so geht es vielfach um diese Einreisebestimmungen: um Zulassungsvorschriften, um Visabestimmungen, um wirksame Kontrollen und um die Bestrafung von Fluggesellschaften, die Passagiere ohne gültige Dokumente transportieren. Aus einsichtigen Gründen sind jene Länder, die die Einreisebestimmungen wirksam durchsetzen können, darauf erpicht, in diesem wichtigen Bereich die nationale Souveränität nicht zu verlieren.
Asylverfahren
Jedes Land kennt ein Asylverfahren. Wer sich mit den einzelnen Verfahrenstypen auseinandersetzt, stellt allerdings fest, daß sie mindestens so verschieden sind wie die Flaggen der einzelnen Nationen. Zwei Grundtypen des Verfahrens treffen wir allerdings an: den Typus des reinen Administrativverfahrens und gemischte Verfahrenstypen, die nach einer ersten Verwaltungsentscheidung den Weiterzug des Verfahrens an Gerichte vorsehen.
Ohne die beiden Grundtypen des Verfahrens näher erläutern zu wollen, sei doch auf zwei Auswirkungen hingewiesen, die mit den beiden Systemen verbunden sind.
- Verwaltungsentscheide müssen oft nicht oder nur rudimentär begründet werden. Eine Verwaltungspraxis kann geheim gehalten werden. Anders ist dies bei unabhängigen Gerichten, die ihre Entscheide veröffentlichen müssen. Die öffentliche Auseinandersetzung über Asylrecht findet daher in den verschiedenen europäischen Staaten in unterschiedlicher Weise statt.
- Verwaltungen sind streng hierarchisch organisiert. Gerichte weit weniger. Eine Verwaltungspraxis kann mittels Weisungen vereinheitlicht werden. Eine Gerichtspraxis dagegen nur über Präjudizien. Dies hat direkten Einfluß auf die Durchsetzbarkeit einer Asylpolitik.
Den unterschiedlichen Verfahrensarten kommt somit große Bedeutung zu, wenn es um die Harmonisierung des europäischen Asylrechts geht.
Anerkennungs- und Abschiebungspraxis
Jedes Asylverfahren endet mit einem Entscheid, einem negativen oder – seltener – einem positiven. Damit sind wir bei der Anerkennungs- bzw. der Abschiebungspraxis der einzelnen Staaten. Auch hier überrascht die Vielfalt. Schauen wir uns die Anerkennungspraxis einmal an: Die Tamilen zum Beispiel werden in Frankreich zu 41 % als Flüchtlinge anerkannt. In der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland wiederum erhalten weniger als 1 % Asyl. Auch bei den türkischen Asylsuchenden gibt es Unterschiede: In der Schweiz werden etwa 5 anerkannt, in der Bundesrepublik Deutschland 12 %. In Italien wiederum werden wegen des geographischen Vorbehaltes keine türkischen Asylsuchenden anerkannt. In Norwegen erhalten 40% der chilenischen Asylsuchenden den Flüchtlingsstatus, in anderen Ländern kaum 5 %. Diese Zahlen allein zeigen, daß die Chancen, Asyl zu erhalten, in den verschiedenen europäischen Staaten sehr unterschiedlich sind.
Die uneinheitlichen Anerkennungsquoten sind zudem ein klares Zeichen dafür, wie wenig heute die Asylpolitik ihrem Inhalt nach harmonisiert ist. Auch wenn alle Staaten denselben Flüchtlingsbegriff anerkennen, so sind die Chancen eines Asylbewerbers, Aufnahme zu finden, in den verschiedenen europäischen Staaten recht unterschiedlich. Ist es den Asylbewerbern zu verargen, wenn sie nach erfolgter Ablehnung in einem Staat ihr Glück in einem anderen suchen? Man spricht heute deshalb auch von der Notwendigkeit einer Harmonisierung des materiellen Asylrechts, einer Harmonisierung der asylrechtlichen Inhalte – und nicht nur der Verfahren.
So wenig einheitlich die Anerkenungspraxis, sowenig einheitlich ist auch die Abschiebungspraxis. Italien zum Beispiel vollzieht kaum je einen Asylentscheid. Man lebt ja bereits mit etwa 800.000 clandestini, auf einige Tausend abgewiesene Asylsuchende mehr oder weniger kommt es da nicht an. Demgegenüber haben die Bundesrepublik Deutschland, Schweden oder auch die Schweiz relativ effiziente Abschiebungsmechanismen entwickelt. Gleichwohl muß festgestellt werden, und dies ist ganz entscheidend, wenn wir die asylpolitischen Realitäten in Europa richtig einschätzen wollen, daß etwa 80 % der abgewiesenen Asylsuchenden in Europa bleiben. Ein Teil davon erhält einen fremdenrechtlichen Status, andere halten sich illegal in den einzelnen Ländern auf, andere wiederum sehen sich zur innereuropäischen Migration gezwungen.
Weil die asylrechtliche Selektion in den wenigsten Ländern wirksam funktioniert, weil also der größte Teil der Asylsuchenden ohnehin hier bleibt, auch wenn sie abgewiesen werden, versprechen sich viele europäische Staaten mehr von wirksamen Einreisebeschränkungen als von einem effizienten Asylverfahren, an das sie nicht mehr glauben.
Zur sozialrechtlichen Stellung der Asylsuchenden
Um ein Bild der asylpolitischen Wirklichkeit in den einzelnen Ländern zu erhalten, müssen wir einen kurzen Blick auf die sozialrechtliche Behandlung der Asylbewerber werfen. Dürfen sie arbeiten? Erhalten sie Fürsorgeleistungen? Werden sie in kollektiven Unterkünften untergebracht? Können sie ihren Aufenthaltsort frei wählen? Noch ist Europa weit von einer einheitlichen Behandlung der Asylsuchenden entfernt. Man spricht zwar von der Notwendigkeit, Europa nicht nur als einheitlichen Wirtschaftsraum, sondern auch als einheitlichen Sozialraum auszugestalten. Die Asylbewerber allerdings dürften vermutlich zu den letzten gehören, die von dieser Angleichung etwas merken werden.
Eine extrem restriktive Behandlung erfahren heute zweifellos die Asylsuchenden in der Bundesrepublik Deutschland. Mit einem fünfjährigen Arbeitsverbot belegt, teilweise in Kollektivunterkünften untergebracht, einzelnen weit entfernten Kommunen zugeordnet, auf minimale Fürsorgeleistungen gesetzt, ist ihr Leben tatsächlich trist. Und wäre da nicht die Chance der Illegalität, der Schwarzarbeit, müßte man von lebensvernichtender Aussichtslosigkeit sprechen.
Besser sieht es für Asylsuchende in Frankreich aus, wo sie zwar nur während einer auf sechs Monate begrenzten Zeit Unterkunfts- und Fürsorgeleistungen erhalten, danach jedoch legal arbeiten dürfen, falls sie eine Arbeit finden.
Schlechter sieht es dagegen in Italien und Spanien aus, wo Asylsuchende keine Arbeitsbewilligung erhalten. Da auch die Fürsorgeleistungen, soweit es welche gibt, kaum ausreichen, sind sie gezwungen, sich mit Schwarzarbeit durchzubringen.
Vergleicht man unvoreingenommen die sozialrechtliche Stellung und die realen Chancen der Beschäftigung, so kommt man im europäischen Vergleich zur Feststellung, daß Asylsuchende in der Schweiz wohl mit Abstand die besten Chancen haben, ein Auskommen zu finden. Auch die Fürsorgeleistungen sind hier und in den skandinavischen Staaten höher als anderswo in Europa.
Geschichtliche Zusammenhänge, kulturelle Unterschiede, politische Präferenzen
Eine Darstellung der Gesetze, Verfahren und Statistiken reicht nicht aus, um die Vielfalt deutlich zu machen, die heute die asylpolitische Wirklichkeit in Europa immer noch prägt. Zu verschieden sind die geschichtlichen Erfahrungen, das koloniale Erbe und das nationale Selbstverständnis der einzelnen Staaten. Wir begegnen diesen Unterschieden sehr sichtbar bei der Abschiebungspraxis der europäischen Staaten. Da stehen nicht mehr die individuelle Gefährdung des Flüchtlings oder die kollektive Repression gegen eine Gruppe im Vordergrund, sondern national geprägte politische Entscheidungen, die die einzelnen Staaten in einem Fall dazu bringen, Abschiebungen vorzunehmen, und in einem anderen veranlassen, beide Augen zuzudrücken.
Wie anders ließe es sich erklären, daß zum Beispiel Österreich kaum ungarische Asylsuchende nach Budapest zurückstellt, die Schweizer Behörden dagegen hier keine Rücksichtnahme kennen. Wie anders ließe es sich erklären, als eben mit den historischen Bedingungen, daß die Bundesrepublik Deutschland Polen nicht in ihr Herkunftsland zurückschicken will, dagegen die Abschiebung der Tamilen nach Sri Lanka als zumutbar erachtet?
Wie anders ließe es sich erklären, daß kaum ein skandinavischer Staat Chilenen in ihr Herkunftsland zurückschickt, die Schweiz dagegen es für durchaus zumutbar erachtet, daß Chilenen heimkehren? Nur auf dem Hintergrund der unterschiedlichen Traditionen läßt sich dieses Patchwork europäischer Abschiebungspraxis verstehen. Schauen wir uns zum Schluß Ursachen für die Vielfalt an:
1. Das koloniale Erbe
Portugal war, wie viele europäische Länder, Kolonialmacht in Südamerika, Afrika und Asien. Noch heute fühlt es sich in hohem Maße Brasilien verbunden. Noch heute erachten Portugiesen die Brasilianer gewissermaßen als ihre Landsleute. Entsprechend können Brasilianer heute noch, wenn sie in Lissabon ankommen, ihren brasilianischen Paß ohne weiteres gegen einen portugiesischen Paß eintauschen. Die engen historischen Bindungen aus der Kolonialzeit begründen dieses Recht, das jedem brasilianischen Bürger die portugiesische Staatsbürgerschaft zusichert.
Mit dem Binnenmarkt 1992 wird nun jeder Portugiese sich irgendwo in der Europäischen Gemeinschaft niederlassen können. Wenn die Gesetze nicht geändert werden, wird demnach jeder Brasilianer die Möglichkeit haben, bei seiner Ankunft in Lissabon den Paß umzuwandeln und damit EG-Bürger zu werden. Noch sagen uns die Portugiesen, es sei für ihr Land nicht denkbar, diese liberalen Vorschriften gegenüber Brasilien abzuschaffen. Noch haben die Strategen von Sehengen diese Lücke nicht entdeckt. Wir brauchen jedoch kein Orakel zu konsultieren, um heute schon mit Bestimmtheit sagen zu können, daß die übrigen EG-Staaten die Abschaffung dieser Regel verlangen werden, spätestens dann, wenn sich die Bewohner der Favelas in Rio de Janeiro einfallen lassen sollten, via Lissabon nach Hamburg an der Elbe umzuziehen.
2. Historische Bindungen
Gerade aber Deutschland wird Schwierigkeiten bekunden, die portugiesische Regelung anzufechten, denn bekanntlich ist die Bundesrepublik Deutschland durch ihre eigene Geschichte mit dem osteuropäischen Raum auf besondere Weise verbunden. Auch ostdeutsche Staatsbürger sind nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Staatsbürger des westlichen der beiden deutschen Staaten. Diese besondere Bindung zu Osteuropa schlägt sich auf die Asylpolitik der Bundesrepublik nieder. Noch immer werden Asylgesuchsteller aus Osteuropa privilegiert behandelt, im Verfahren und sozialrechtlich. Noch immer hält die Bundesrepublik an der Fiktion fest, alle deutschstämmigen Personen in Osteuropa müßten in der Bundesrepublik Deutschland Aufnahme finden, auch wenn die entsprechenden Geburtszertifikate in Polen und anderswo schon längst käuflich zu erwerben sind. Indirekt wirkt sich die steigende Zahl von Aussiedlern auf die Asylpolitik der Bundesrepublik aus.
Am Beispiel der Aussiedler wird gleichzeitig deutlich, welche Konsequenzen sich für die Asyl- und Migrationspolitik Westeuropas längerfristig ergeben könnten, wenn Osteuropa tatsächlich die Ausreise liberalisieren sollte. Bereits in diesen Monaten reisen monatlich etwa 700 Pfingstler aus der Sowjetunion in Italien ein, die kaum auf sofortige Weiterreise in ein Drittland zählen können. Man rechnet für die nahe Zukunft mit 2000 pro Monat. Eine Lockerung der Ausreisebestimmungen durch die osteuropäischen Staaten, wie im Zuge von Glasnost zu erwarten ist, könnte die westeuropäischen Staaten und namentlich die Bundesrepublik, Österreich und Italien vor ernste Probleme stellen. Zu lange hat man im KSZE-Prozeß die freie Ausreise als Test für die Menschenrechte propagiert, als daß man nun ohne weiteres die Minenfelder des eisernen Vorhanges auf die westliche Seite verlegen könnte. Historische und politische Bedingungen prägen in viel größerem Ausmaß die nationale Asylpolitik der einzelnen Staaten, als dies die Diskussion um die Harmonisierung des Asylrechts vermuten ließe.
In ganz besonderem Maß gilt dies für das jeweilige Verhältnis zwischen der Asylpolitik und der Einwanderungspolitik in den einzelnen Ländern. Schweden beispielsweise kennt keine eigentliche Einwanderungspolitik. Soweit legale Einreisen stattfinden, erfolgen sie fast ausschließlich über die Asylpolitik. Dies erklärt, warum Schweden in so großzügigem Maße Asylsuchende aufnimmt. Dies ist weniger Ausdruck asylpolitischer Freizügigkeit als vielmehr des wirtschaftlichen Bedürfnisses nach einer gewissen Immigration. So erklärt sich letztlich auch die besondere Haltung der südeuropäischen Staaten in Asylfragen. Jahrzehntelang waren sie klassische Auswanderungsländer. Ihre besten und tüchtigsten Leute verließen das Land. Einwanderung war nicht ihr Problem – Auswanderung war das Problem; auch Flüchtlinge wollten in der Regel weiter. Die südländische Gelassenheit in Asyl- und Migrationsfragen hatte also ihren realökonomischen Boden.
Es bleibt jedoch zu hoffen, daß etwas von dieser Gelassenheit und gesellschaftlichen Freizügigkeit für das europäische Asylrecht gerettet werden kann, bevor der systematische, schwerblütige Norden seine Gesetze allgemeinverbindlich erklärt.
aus: Asyl, Schweizerische Zeitschrift für Asylrechtspraktiker, Nr. 2/1989
Walter Schmid ist Direktor der Schweizerischen Zentralstelle für Flüchtlingshilfe (SFH) Adresse: SFH, Postfach 279, 8035 Zürich