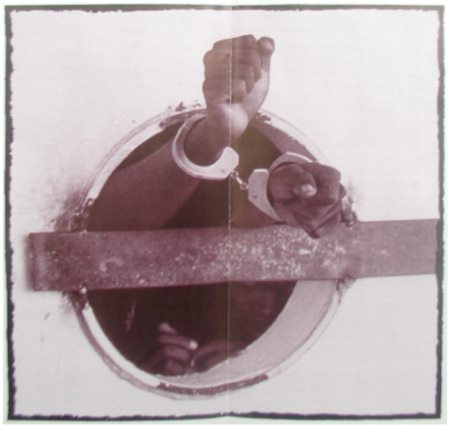TAG DES FLÜCHTLINGS 1993
DER ENGEL VON MARSEILLE
Fritz J. Raddatz
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR)
- Auf dem Weg nach rechts
- Der Engel von Marseille
- „Hört auf, vom Mißbrauch des Asylrechts zu reden“
- Fehlentscheidungen des Bundesamtes – Korrektur durch Gerichte
- In die Flucht geschlagen: Warum Menschen fliehen
- Kirchenasyl
Wir schreiben Herbst 1940. Frankreich ist von der deutschen Armee überrannt. Entgegen dem internationalen Asylrecht hat die Siegermacht der Petain-Regierung den Artikel 19 des Waffenstillstandsabkommens diktiert, nach dem sie auf Verlangen Flüchtlinge an die Besatzungsbehörden ausliefern muß. Für Tausende antifaschistischer deutscher Emigranten, die sich noch in die unbesetzte Zone im Süden Frankreichs retten konnten, hat die Stunde der Panik, Not und Angst geschlagen. Die meisten, unbemittelt, haben keine oder falsche Papiere, sind auf die Gnade mitleidiger Hotelbesitzer, die Mildtätigkeit eines Bäckers und das Augenzudrücken eines Streifenpolizisten angewiesen. Selbst die Zuversicht so weltberühmter und – noch – wohlbemittelter Künstler wie Lion Feuchtwanger oder Franz Werfel, die ausgestattet mit Personal, vollen Weinkellern und Limousinen, komfortable Villen in Sanary-sur-Mer bewohnen, ist trügerisch. Sehr bald sind auch sie gehetztes Wild, das vor der letzten vermeintlichen Ausfallpforte Marseille lungert. Allein das Alphabet der betuchten Deutschen – deren Auslieferung Rücktransport in KZ und Tod bedeutet hätte – reicht von Georg Bernhard und Alfred Döblin über Annette Kolb, Walter Mehring und Franz Pfemfert bis zu Fritz von Unruh und Kurt Wolff.
Da wird im Spätsommer 1940 in New York ein von liberalen Intellektuellen und Quäkern initiiertes „Emergency Rescue Committee“ gegründet, das sich zur Aufgabe macht, gefährdete Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler zu retten. Man wählt einen jungen Historiker aus gutem Hause, den 33jährigen Harvard-Absolventen und Mitarbeiter renommierter amerikanischer Zeitschriften Varian Fry, zum Chef dieser überaus heiklen europäischen Mission, deren Schwierigkeiten man in New York gewaltig unterschätzt. In dem Bestellungsschreiben vom 5. August 1940 heißt es: „Wir haben vereinbart, daß Sie New York per Flugzeug am Sonntag, den 4. August verlassen und am 29. August per Flugzeug zurückkehren.“
Aus den fünfundzwanzig Tagen wurden knapp vierzehn Monate – in denen schier Unglaubliches geschah. Die Taschen vollgestopft mit Geld und Listen von vielen hundert Flüchtlingen, landete Varian Fry nach kurzem Lissabon-Aufenthalt in Marseille und nahm ein winziges Zimmer im Hotel „Splendide“. Von hier aus, an einer umgebauten Frisierkommode, auf der Bettkante sitzend, anfangs ohne Mitarbeiter und allmählich mit einem zuverlässigen Stab arbeitend, wob Varian Fry sein Spinnennetz.
(…)
Fry verbündet sich mit einem der Unterweltbosse von Marseille: „Nach außen war Jacques der Besitzer eines renommierten Restaurants mit dem Namen ,Sept Petits Pecheurs‘. Privat war er der Kopf einer der führenden korsischen Banden von Marseille. Vor seinem Restaurant boten Straßenhändler lautstark Muscheln, Seeigel und Garnelen an, während drinnen Marseiller Geschäftsleute, Flüchtlinge aus Paris und amerikanische Wohlfahrtshelfer aßen. Jacques überwachte das Geschehen argwöhnisch, trank Sodawasser und führte die Geschäfte von seinem Platz hinter der Kasse. Seine Privatgeschäfte bestanden vermutlich aus Bordellbetrieb, Schwarzmarkt und Kokainhandel.“
Als Fry mit Hilfe dieses gnädigen Gangsters ein Auto für die Flucht zweier Weimarer Spitzenpolitiker, des Innenministers Rudolf Breitscheid und des Finanzministers Rudolf Hilferding, nach Lissabon besorgt hatte – schickten die es weg: Sie hatten es sich anders überlegt. Sie schlugen auch die nächste Chance aus, der drohenden Vernichtung zu entkommen.
Es ist ein Verwirrspiel ohne Ende; ohne Gesetze auch. Varian Fry, der zur Tarnung ein offiziell akkreditiertes Büro für Flüchtlingshilfe dirigiert, das unter dem Patronat unter anderem von Henri Matisse und Andre Gide operiert, ist so unermüdlich wie erfinderisch. Schwarzmarktgeschäfte mit Dollars gehören zu seiner täglichen Routine wie die Bestechung von Konsulatsbeamten, der Kauf falscher Pässe und Visa. Mal muß er dem durch seine Intervention knapp der Verhaftung entronnenen Marc Chagall auf dessen Frage: „Gibt es in Amerika auch Kühe?“ beruhigend antworten, mal muß sein Konsulatskollege Hiram Bingham Lion Feuchtwangers Flucht aus dem französischen Internierungslager bewerkstelligen. Es gilt, sich zu erinnern – auch der französischen Schande: Schritt für Schritt wurde die nationalsozialistische „Judengesetzgebung“ auf Frankreich übertragen: Auf dieser Grundlage erfolgte von Dezember 1941 an die Deportation „nach dem Osten“. Doch viele der deutschen Emigranten mußten erst aus den französischen Lagern – in die man sie unbeschadet ihres Anti-Nazi-Exils, als feindliche Ausländer gesperrt hatte – fliehen oder befreit werden; wenn sie sich nicht, wie Walter Hasenclever, dort umbrachten.
In solchen Lagern saßen Peter Pringsheim (Thomas Manns Schwager), der Kunsthistoriker Paul Wertheim, der exkommunistische Verleger Willi Münzenberg und Walter Benjamin. Auch hier half Varian Fry – etwa bei der berühmt gewordenen Flucht Feuchtwangers in Frauenkleidern.
Gerettet hieß aber noch nicht in Sicherheit. Ausreisebestimmungen, Einreiseerlaubnis nach Spanien, Transitvisa von Portugal, die Regeln und Kosten für Schiffspassagen, das alles änderte sich oft innerhalb einer Woche. Hatte Fry endlich litauische Pässe ergattert, wurden sie plötzlich nicht mehr anerkannt; hatte er eine absolut sichere Quelle für spanische und portugiesische Visa entdeckt, stellten die sich als gefährdend plumpe Fälschungen heraus; hatte er für viel Geld einen angeblichen Diplomaten bestochen, Flüchtlinge im Wagen nach Lissabon mitzunehmen, so waren Geld, Auto und Diplomat in der Nacht von Marseille verschwunden. Zwischen Haussuchungen, Verhören und immer dringlicher werdenden Abmahnungen des auf Appeasement gedrillten US-Konsulats mußte Fry neue Routen, Schmuggelpfade und Schiffspassagen ausfindig machen.
Es ist schier unbegreiflich, mit welch gerissener Zähigkeit, fünfzehn Stunden pro Tag, dieser junge Amerikaner, „der Menschenfischer von Marseille“, dort einen Schmalzfabrikanten auftat, dessen vulgäres Französisch und „Patois“ mehrerer Landschaften den Hafengangstern Vertrauen einflößte, und da eine Bordellmutter gewann, weil man in den „Maisons de passe“ keine Papiere brauchte. Dem „Professor Whitaker“, wie sie ihn in ihrem Roman“ Transit“ nannte, hatte auch Anna Seghers ihre Flucht auf einem der wenigen auslaufenden Schiffe zu verdanken; sie hat ihm im 9. Kapitel ihres „Transit“-Romans ein Portrait gewidmet. (…)
Die Flucht zu Fuß über die Pyrenäen, zumeist im Morgengrauen als Weinbauern verkleidet mit nichts als dem für das Mittagsbrot geknüpften karierten Tuch an der Hacke über der Schulter, war mühsamer. Sie mußte auch wegen der Grenzzöllner und dem verminten Gelände akribisch vorbereitet werden. Die Botschaften über gängiges oder gefährliches Gelände chiffrierte Varian Fry mit Hilfe eines Textes von Thomas Carlyle aufs komplizierteste durch eine Buchstaben- und Zahlenkombination -, ein Codesystem, das der Royal Navy alle Ehre gemacht hätte. Einer dieser Fluchtversuche ist mit seinem tragischen Ausgang inzwischen ein Stück deutscher Literaturgeschichte – Walter Benjamin. Er ging wie so viele aus von dem Haus der deutschen Emigranten Hans und Lisa Fittko, die als Monsieur Jean und Madame Lise, geschützt vom sozialistischen Bürgermeister‘ des Ortes, in Banyuls am Fuße der Pyrenäen, zumeist auf Bitten von Varian Fry zahllosen Flüchtlingen über die Berge ins rettende spanische Port Bou halfen. (…)
Auch Heinrich Mann und seine Frau gehörten zu Varian Frys Kunden. Das Ehepaar Mann mußte sich entscheiden. Sie hatten echte tschechische Pässe auf den Namen Mann, die ihnen von den tschechischen Behörden ausgestellt worden waren, als man ihnen die tschechische Staatsbürgerschaft zuerkannte. Aber sie hatten auch amerikanische Papiere, in denen ihre Nachnamen weggelassen worden waren: Sie hießen einfach Herr und Frau Heinrich Ludwig. Wir hielten es für zu riskant, sie als Herr und Frau Heinrich Mann durch Spanien fahren zu lassen, also gaben sie mir ihre tschechischen Pässe. Auf dem Rückweg ins Hotel – wir mußten noch bezahlen und unsere Sachen zusammenpacken – ließ ich sie ihre Taschen und Notizbücher durchsuchen und alles entfernen, was den Namen Mann trug – Visitenkarten, Briefe und was sie sonst noch bei sich hatten. Als ich Heinrich Mann bat, mir seinen Hut zu geben, und mit dem Taschenmesser die Initialen vom Hutband abkratzte, machte er ein so ernstes Gesicht wie ein zum Tode Verurteilter. „Wir müssen uns wie richtige Verbrecher benehmen“, sagte er.
Kaum waren einige gerettet, drängten sich andere. In den Straßen Marseilles sah man immer mehr der unheimlichen Gestalten in langen grauen Mänteln und hohen schwarzen Stiefeln. Nur flüsternd gab der eine dem anderen die Kunde von dem unbekannten Amerikaner und seinem anonymen Komitee. Manchmal trafen die ersehnten Visa ein – für Tote. Für Ernst Weiß, für Walter Hasenclever. „Kann man uns vielleicht an ihre Stelle setzen?“ fragten Walter Mehring und Leonhard Frank. Nein auch dazu benötigte man eine Genehmigung. Carl Einstein, der Poet und Theoretiker der Negerplastik, erhängte sich in Marseille, als man ihn von der Grenze zurückgeschickt hatte.
Das Beschaffen von Visa und Pässen und Bürgschaften und Schiffspassagen war so schwierig, wie das Geld aus New York ins Land zu bekommen, von dem er ja nicht offiziell ausweisen konnte, wo es blieb. Die schwarzen Geldgeschäfte sind so abenteuerlich wie die von einem Wiener Zeichner originalgetreu imitierten Stempel oder die am Hafen gekauften chinesischen Einreise-Visa, die in Übersetzung lauteten: „Der Inhaber dieses Passes darf unter keinen Umständen nach China einreisen. “
Diese ominösen Listen, aufgrund derer Varian Fry die Hilfsbedürftigen in ganz Südfrankreich suchte, waren damals Elends-Rollen; heute lesen sie sich wie Ehrentafeln: Siegfried Kracauer und Max Ernst, Jacques Lipschitz und Marc Chagall, Valeriu Marcu und Peter Pringsheim, Hans Siemsen und Hans Sahl. Von ihm stammt die wohl eindringlichste Skizze dieses rasch und zu Unrecht vergessenen Mannes, dem Tausende ihr Leben zu verdanken haben: „Als ich die Tür öffnete und eintrat, kam mir ein freundlicher junger Mann in Hemdsärmeln entgegen, legte den Arm um mich, stopfte mir einige Geldscheine in die Tasche, zog mich zum Fenster und wisperte, wie ein nicht sehr guter Schauspieler, der eine Verschwörerrolle spielen soll: ,Wenn Sie mehr brauchen, kommen Sie wieder. Inzwischen werde ich Ihren Namen nach Washington kabeln. Wir werden Sie herausbringen. Es gibt Wege, Sie werden sehen, oh, es gibt Wege: …‘ Er goß mir ein Glas Whisky ein. ,Ubrigens brauchen Sie einen neuen Anzug. Sie können nicht mehr so herumlaufen. Wir werden Ihnen morgen einen hübschen Sommeranzug kaufen.‘ Ich goß den Whisky herunter und sagte abwechselnd ,Thank you very much, Sir‘ und ,Danke vielmals‘ und ,Merci, monsieur‘.“
Rasch und zu Unrecht vergessen. Tatsächlich hat dieser rastlos um das Leben Fremder besorgte Mann wenig Dank geerntet: Noch während seiner Monate in Marseille häuften sich die Schwierigkeiten, sowohl mit den immer mißtrauischer werdenden und den Nazis immer hilfswilliger zuarbeitenden französischen Behörden als auch mit dem amerikanischen Konsulat. Das ging so weit, daß man ihm erst seinen Paß nicht verlängerte, ihn schließlich ganz einzog mit der Maßgabe, er bekäme ihn nur zur sofortigen Ausreise und Rückkehr in die USA ausgehändigt. Ungeschützt von der eigenen Botschaft – die bei der Petain-Regierung in Vichy akkreditiert war -, hatte Fry immer peinigender werdende Haussuchungen und Verhöre zu bestehen.
Zurückgekehrt in die USA, ist Varian Fry rasch vergessen worden. Er schlug sich kärglich durch von einem Job zum anderen, zuletzt als Lateinlehrer an einer Provinzschule. Von einer Geste gar Hilfsaktion – seiner inzwischen hoch vermögenden Freunde ist nichts bekannt. Kein Chagall-Portrait, keine Max-Ernst-Collage geben von ihm Zeugnis. Zwei der engsten Angehörigen des in behaglichen Verhältnissen lebenden Thomas Mann hat er gerettet – in den Tagebüchern des eisigen „Zauberers“ taucht der Name, falsch geschrieben, in einem Nebensatz auf.
Selbst sein Tod im Jahre 1967 blieb im dunkeln – niemand wußte, ob der in der McCarthy-Ära „wegen Zusammenarbeit mit Kommunisten“ Verdächtigte sich umgebracht hatte, als man den Toten allein in seiner Wohnung fand. Der Nachruf im New Yorker Aufbau erinnerte daran, daß „eine ganze vertriebene Kultur Fry ihr Überleben verdankt“. Unter der Überschrift „Ein unbesungener Held starb“ heißt es da: „Mit dem Schmerz um seinen Tod verbindet sich tiefe Dankbarkeit für seine einzigartige Leistung, gleichzeitig aber auch ein Gefühl der Enttäuschung darüber, daß Amerika, das zur ständigen Heimat vieler der von ihm geretteten Kinder Europas wurde, für seinen eigenen Sohn keine Stelle fand, die seines Geistes und Talents würdig gewesen wäre.“