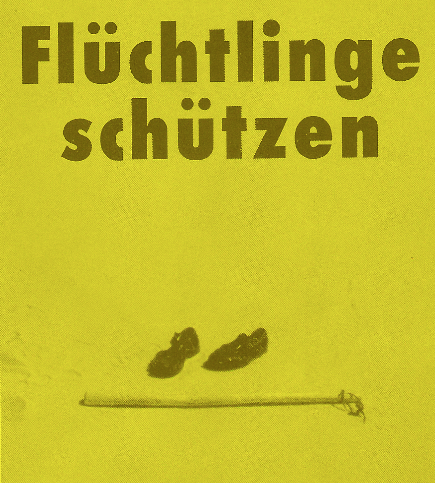TAG DES FLÜCHTLINGS 1992
Afghanistan
INHALT
- Grußwort des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
- Warum sind Menschen auf der Flucht?
- Türkei
- Iran
- Afghanistan
- Sri Lanka
- Somalia
- Jugoslawien
- Rumänien
- Zwischenbilanz zum Thema Europa und Asylrecht
- Hetze, Missbrauch, Angst und Mitleid
- Was Sie tun können?
- Auszeichnung für PRO ASYL
Obwohl die Sowjets Afghanistan verlassen haben, wird der blutige Bürgerkrieg weitergeführt. Selbst wenn die Kampfhandlungen eingestellt würden, könnten die 5 Millionen Flüchtlinge, die zumeist in Flüchtlingslagern in Pakistan und Iran leben, nicht von heute auf morgen in ihre Heimat zurückkehren. Ihre Existenzgrundlagen sind zerstört.
In der Bundesrepublik beantragten im Jahr 1991 7.337 Menschen aus Afghanistan Asyl, 41,5 Prozent wurden als asylberechtigt anerkannt. Sie erhalten jedoch nur Asyl, wenn sie als politische Gegner des Regimes bekannt sind. Aber auch eine Abschiebung von Flüchtlingen aus Afghanistan, die bislang in der Bundesrepublik kein Asyl erhalten oder „geduldet“ wurden, wie zum Beispiel Deserteure, ist angesichts der unsicheren Bürgerkriegslage mit einem hohen Gefährdungsrisiko verbunden. Rückkehrer sind im besonderen Maße der Willkür des Geheimdienstes Khad ausgliefert, dem schon der leiseste Verdacht der Regimegegnerschaft zur Einleitung von Verfolgungsmaßnahmen genügt.
Zur Zeit gibt es einen Abschiebestopp für afghanische Flüchtlinge. Halbjährlich wird jedoch darüber entschieden, ob er verlängert wird.
Geschichte des Konflikts
Der Afghanistan-Konflikt beginnt im Jahr 1977, als General Mohammed Daud die Republik in eine Diktatur verwandelt. Als Daud versucht, das Land dem Westen zu öffnen, putscht – im April 1978 – Mohammed Taraki, der Chef der verbotenen Kommunistischen Partei. Die sogenannte Saur-Revolution stößt auf den erbitterten Widerstand der Landbevölkerung, an deren Spitze sich radikale Islamisten setzen. Die Reformen der Kommunisten munden in ein Chaos. Im September 1979 stürzt Außenminister Hafizullah Amin den Putsch Präsidenten Taraki. Um die „Errungenschaften der Revolution“ zu retten und einen Pufferstaat für die eigenen Sicherheitsinteressen zu schaffen, besetzt die Sowjetarmee am 27. Dezember 1979 das Land, ermordet Amin und setzt Babrak Karmal als Marionettenpräsidenten ein. Der Partisanenkrieg eskaliert. Die USA beginnen mit massiver Waffenhilfe für die Mudschaheddin. Zwischen Mai 1988 und Februar 1989 ziehen die Sowjets ihre Besatzungstruppen ab, die Kämpfe gehen trotzdem weiter. Das Land der Paschtunen, Belutschen, Tadschiken und Turkmenen sei nach zwölf Jahren Krieg das ärmste der Welt, schreibt die New York Times.
Kriegsfolge
Von der 1987 etwa 16 Millionen Menschen umfassenden Bevölkerung starben aufgrund von Kriegseinwirkungen, von Verfolgung und Ermordung politischer Gegner circa 1 Million, 3,5 Millionen flohen nach Pakistan, 1,5 Millionen in den Iran und ca. 100.000 nach Indien und ins westliche Ausland. Die meisten Flüchtlinge verließen ihre Dörfer und Häuser erst, nachdem ihre Unterkünfte mehrmals zerstört, ihre Ernten verbrannt, ihre Tiere umgebracht und die Männer umgekommen waren. Oft taten sich mehrere Personen aus dem Dorf, Stamm oder der Familie zusammen und begannen zu Fuß, mit Eseln, Maultieren oder Pferden den Treck zur Grenze. Oft dauerte es Wochen und Monate, bis die Flüchtlinge sich an einem zugewiesenen Platz niederlassen konnten.
Doch obwohl inzwischen die sowjetischen Truppen abgezogen sind, geht der Bürgerkrieg weiter: Liberale Muslime kämpfen gegen die Fundamentalisten, beide gemeinsam gegen die Regierung von Präsident Nadschibullah.
Der Journalist Thomas Kleine-Brockhoff berichtet in DIE ZEIT vom 15.11.1991 in seinem Dossier „Land der Krüppel“:
„Als sei, es ein grausamer Herbstritus, rennen die Mudschaheddin alljährlich gegen die letzten Bastionen des Kabuler Regimes an – zehn, zwölf größere Städte, aus der Luft versorgte Inseln, mit schwerer Artillerie, Panzern, Kampfbomben und Raketen verteidigte Festungen. Und wie immer bleiben die Angriffe im Sperrfeuer über den Minengürteln stecken. Die Opfer kommen, sofern sie überleben, ins, Notspital der Kleinstadt Khost, wo vierzig Kilometer östlich des Belagerungsringes um Gardez, nur ferne Scud-Einschläge zu hören und die Sandfahnen endloser Nachschubkonvois zu sehen sind.
[…] Die Ärzte amputieren wie am Fließband, zwanzig Stunden am Tag, 279 0perationen in zwanzig Tagen: Finger, Füße, Arme, Unterschenkel, ganze Beine, alles, was Minen und Granaten zerfetzten.“
Dies geschieht vor dem Hintergrund eines riesigen Waffenarsenals, das die Sowjetunion der Regierung überlassen hat. Andererseits sorgen ausländische Lieferanten dafür, daß die Waffenlager der Guerillas mit Gewehren und Munition aufgefüllt werden. Erst ab 1992 besteht Hoffnung, daß die USA und die UdSSR aufgrund ihres Abkommens keine Waffen mehr nach Afghanistan liefern werden. Wie sich die Folgen des Krieges im Alltag der Menschen widerspiegeln, zeigen die folgenden Auszüge aus der Reportage des Zeit-Journalisten auf eindringliche Weise:
Achtung, Minengefahr!
„Selbst unter Kalaschnikow-Bewachung gleicht eine Fahrt durch Afghanistan einem Hasardspiel. Wo nicht mehr gekämpft wird, sterben die Menschen am Nachlaß des Krieges. Überall unter den Staubpisten lauert der Minentod. Die Angst davor macht aus einstmals schnurgeraden Schotterstrecken Zickzackrouten. Ein Gerücht reicht aus, und schon umrunden die Fahrer Büsche, Felsen, Hügel auf netten Wegen. Die alte Strecke wird dann mit kleinen Steinhaufen und grünen oder roten Kreuzen markiert: Achtung, Minengefahr! Das Risiko wächst nach starken Regenfällen. Dann wäscht das Wasser vergrabene Panzerminen aus.
Niemand weiß, wie viele Sprengsätze im Boden stecken. Es könnten fünf Millionen sein, auch zwanzig oder fünfzig. Gewiß ist nur: Afghanistan ist das größte Minenfeld der Welt.
Kein Bauer kann auf seinem Acker sicher sein. Zu Hunderttausenden haben die Kabuler Soldaten Sprengkapseln aus Flugzeugen abgeworfen. Manche explodieren durch Berührung, andere durch Vibration. Die kleinsten, elf Zentimeter breit, sehen aus wie Spielzeugschmetterlinge. Aufheben kostet den Arm, drauftreten den Fuß. Deshalb gilt für Kinder: Dorfumfriedung nicht verlassen!
In die Nähe der Vorgebirgshügel traut sich niemand. Die schönsten Aussichtspunkte sind Todesfallen. Dort hatten die Regierungstruppen vor dem Rückzug ihre Artilleriestellungen durch riesige Minengürtel vor den anstürmenden Mudschaheddin gesichert. Weil es keine Zäune gibt, grast überall Vieh an den Todeshängen. Die Tiere sind zumeist der letzte Besitz der Bauern, aber über tote Ziegen mag kaum jemand klagen in einem Land, in dem jeder zerfetzte Freunde, Verwandte, Nachbarn hat. In den Wartezimmern der Krankenhäuser hängen als Warnung Schaukästen mit entschärften Minen. Es ist eine makabre Typen-Parade: sowjetische OZM 72, tschechoslowakische PP MI SR, italienische SH 55. Es gibt sie in allen Größen und Formen – Panzerminen wie Hutschachteln oder Radfelgen; Schützenminen wie Griffelkästen, Konservendosen oder wie Rotorblätter; Mini-Minen wie Tennisbälle oder Eier. Manche sind aus Plastik, damit sie nicht mit Detektoren geortet und geräumt werden können; einige Stahlminen haben Sollbruchstellen, damit sich nach der Explosion möglichst viele Splitter in den Körper bohren.
Überlebende können kaum auf Hilfe hoffen. Die Ärzte der wenigen unbeschädigten Krankenhäuser kennen mangels Ausrüstung meist nur eine Therapie: amputieren! Eine halbe Million Krüppel gibt es schon, schätzen die Vereinten Nationen. Und weder das Ende des Minenkrieges ist in Sicht noch der Beginn einer riesigen Räumkampagne.
Bis heute sind im „befreiten Teil“ Afghanistans nur 350 Detektoren und zwei Spezialfahrzeuge im Einsatz. Sie gehören den Vereinten Nationen, die vor drei Jahren mit der „Operation Salam“ begonnen haben. Gerade mal fünfzehn Straßen sind seither „gesäubert“, was aber angesichts eines Jahresbudgets von sechzehn Millionen Dollar schon als Erfolg gelten muß.
Anfangs wollte „Salam“-Direktor Sayed Aqa drei Männer aus jedem Dorf ausbilden und zum Räumen nach Hause schicken. Als sich herausstellte, daß viele Bauern die Minen sofort wieder zu den Mudschaheddin an die Front trugen, war’s vorbei mit der Massenausbildung. Inzwischen arbeiten nur noch professionelle, streng überwachte Teams, dafür geht alles langsamer als zuvor. Bei gleichbleibendem Räumtempo wird Afghanistan in frühestens hundert Jahren minenfrei sein.
Weil die Bauern darauf nicht warten wollen, helfen sie sich selbst. Wer genug Erfahrung und Mut hat, legt sich auf den Bauch und robbt vorsichtig zur Mine vor, die rechte Hand voraus, die linke an der Hosennaht, damit, wenn’s kracht, nur ein Arm weg ist. “
Warum er aus Afghanistan floh:
Shapoor, 28 Jahre alt.
Vor acht Jahren kamen die Russen in unser Land und mit ihnen eine kommunistische Regierung. Deswegen mußten mehrere Millionen Menschen aus Afghanistan weggehen, nach Pakistan, Indien, Deutschland, Amerika, in alle Länder. Wir möchten keine Regierung, die Menschen umbringt. Und diese kommunistische Regierung sagt, daß alle jungen Menschen für drei Jahre zum Militär gehen müssen, um gegen Mudschaheddin zu kämpfen. Aber wir möchten nicht gegen Mudschaheddin kämpfen, weil wir auch Mudschaheddin sind.
Ich selbst habe nicht mit Gewehren gekämpft. Es gibt verschiedene Arten zu kämpfen. Meine Familie hat den Mudschaheddin geholfen, weil unser Haus in Kandahar war. Kandahar ist das Zentrum des Kampfes. Und wir haben den Mudschaheddin auf andere Art geholfen, mit Essen, Tee, Geld und Informationen.
Ich war ein Ladenbesitzer, ein Geschäftsmann, genau wie mein Vater. Wir kauften Tee aus China und Indien und brachten ihn her und verkauften ihn. Ich hatte viel Geld und viele Sachen zum Leben. Deshalb konnte ich die Mudschaheddin auf verschiedene Weise unterstützen.
Wir waren zu zwölft in meiner Familie: mein Sohn, meine Frau, vier Brüder, vier Schwestern und meine Eltern. Wir haben alle zusammengewohnt. Vor 14 Monaten wurde unser Haus bombardiert, und einer meiner Brüder starb. Meine Schwester und mein Vater wurden durch Splitter in den Armen und in der Brust verletzt. Meine ganze Familie war im Haus, nur ich war im Laden. Ich war der einzige, der arbeitete. Mein Vater war schon 65 und zu alt, und meine Brüder gingen noch zur Schule, einer studiert. Ich habe für die ganze Familie gesorgt.
Jeden Tag wurden Häuser zerstört, an diesem Tag war es unser Haus. Wenn man nach Kandahar geht, findet man kein ganzes Haus mehr; alle Häuser sind heute Staub. Diese Regierung unternimmt nichts, ohne Menschen zu töten.
Als die Russen und die Regierung erfuhren, daß ich den Mudschaheddin geholfen habe, bin ich aus Afghanistan geflohen. In Pakistan leben Millionen von Flüchtlingen, aber alle sind Moslems. Ich dachte, daß ich mit ihnen in keinem Flüchtlingslager leben kann, denn wir sind Hindus. Deshalb bezahlte ich viel und kam nach Deutschland, obwohl ich von Deutschland wenig wußte.
Nachdem ich geflohen war, kamen Regierungssoldaten zu meinem Haus und fragten, wo ich sei. Sie sagten meinen Eltern, daß sie gehört hätten, daß wir den Mudschaheddin zu essen gegeben hätten und sie unterstützt hatten. Mein Vater ist alt und sagte: „Ich weiß von nichts.“ Er sagte auch, er wisse nicht, wo ich sei. Da schrieben mir meine Eltern einen Brief, daß ich nicht mehr zurückkommen sollte.
Die Flucht war sehr schwierig. Zuerst traf ich Mudschaheddin. Sie nahmen mich von Kandahar nach Charnan mit. Danach kamen wir, als wir Pakistan erreichten, nach Quetta, eine Woche in Karatschi, dann kam ich nach Deutschland.
Nachdem ich mit meiner Frau und meinem Sohn nach Deutschland geflohen bin, gingen meine Eltern nach Kabul. Wovon meine Eltern dort jetzt leben, weiß ich nicht. Mein Vater hat ein wenig Geld gespart, aber wie lange wird das reichen?
Irgendwann werden wir heimkehren. Wir müssen in unser Land zurück. Alle Menschen lieben ihr Land. Es ist zu schwierig, wenn wir hier und die Eltern dort sind.
Aus: Zentralstelle für die Integration von Zugewanderten: Flüchtlingsschicksale
Quellen und weiterführende Literatur:
Jan-Heeren Grevemeyer: Die Afghanen: Widerstand und Flucht, in: Flucht und Asyl. Berichte über Flüchtlingsgruppen, Berlin 1988. Zeitdossier: Im Land der Krüppel, Die Zeit, Nr. 47, vom 15.11.1991
Zentralstelle für die Integration von Zugewanderten: Flüchtlingsschicksale, Bremen 1991
Bezug: Zentralstelle für die Integration von Zugewanderten, Knochenhauer Straße 20-25, W-2800 Bremen 1